Copyright Ⓒ Gerhard Hess - 22.08.2013

Die Hauptkultstätte der Chatten/Hessen - Gudensberg bei Fritzlar -Kupferstich aus „Meisners Schatzkästlein“, 1678
Die OD-Kultstätten unserer germanischen Heimatreligion
Ein besonderes Wunderreich voller Sagen und Märchen ist die einzigartige Basaltkuppenlandschaft des Chattengaues, wenige Meilen südlich von Kassel. (Abb. Sicht vom Odenberg auf Gudensberg, 1628) Gegenüber dem Gudensberger Schlossberg, nach Kassel hin, reckt sich die geheimnisumwitterte Basaltkuppe des Odenberges, Wodanberges, den zahlreiche Sagen mit „Kaiser Karl“ oder dem „Quintes“ in der Weise in Verbindung bringen, dass dieser im Odenberg schlafen würde und ausruht für den letzten siegreichen Kampf. Wenn der anhebt, wird er wieder hervortreten, um das Land vor dem Untergang zu retten. Eine andere Sage berichtet, dass er, zusammen mit seinem „Wilden Heer“, dort so lange bleiben muss bis der letzte Rabe verschwunden ist, der um seinen Berg kreist. Noch im Jahre 1812, in der vaterländischen Not des Franzoseneinfalls, versammelten sich die Landleute aus den umliegenden Dörfern unterhalb des Odenberges, um das Hervorkommen des rettenden „Kaiser Karls“ zu erwarten, so dass sie von den Soldaten Napoleons zerstreut werden mussten. Mit „Karl Quintes“ ist letztlich kein historischer Herrscher gemeint, sondern Wodan, der Volks- und Hauptgott der Deutschen. „Quintes“ könnte aus lat. quintus, „der Fünfte“, verstanden werden, denn 5 galt als Rundzahl der Vollkommenheit. Als Wodan dem Kirchenglauben weichen sollte, versetzte ihn die Volkspoesie in den Odenberg, wo er als bergentrückter Held irgendwann auferstehen und seine segensvolle Herrschaft wieder aufnehmen werde. Der Name Karl, im Sinne von „Herr“, versteht sich als ein Kultname Wodans, wird doch auch der Himmels- oder Wodanswagen, auf dem der Gott alltäglich sein himmlisches Reich umfährt, als Karls- oder Herrenwagen bezeichnet (dän. Karlsvogn, schwed. Karlwagn). Ein Sagenstrang lässt ihn jeweils im siebten Jahr in seiner Eigenschaft als Totengeleitgott an der Spitze seines treuen Gefolges aus dem Berg hervorgehen, um in der Nähe des dortigen Glissborns eine große Heerschau abzuhalten. Die Sage liebt es zuweilen, die Gestalten hoher Gottheiten auf bedeutende geschichtliche Persönlichkeiten zu übertragen und die religiösen Mythen auf einem markanten geschichtlichen Hintergrund zu beschreiben. Die gleichen Sagen vom „Kaiser Karl“, oder „Kaiser Barbarossa“, die Mythen vom Rabenflug, von ursprünglich Wodans „Wildem Heer“, der „Wilden Jagd“ bzw. „Wilde Gjoad“, erzählt sich das Volk nicht allein vom Odenberg (381,2 m), ebenso auch vom Kyffhäuser (473,6 m), südöstlich des Harzes in Thüringen, wie vom Untersberg (1.973 m), einem Bergmassiv der Nördlichen Kalkalpen auf der Grenze zwischen Bayern und dem Salzburger Land. Wie weit in germanischen Landen die Gleichklänge reichten ersehen wir am weiteren Beispiel der Burg Karlsberg (Karlsburg) im südlichen Böhmerwald, die der deutsche Kaiser Karl IV. (1316-1378) erbauen ließ. 300 Meter östlich davon liegt ein kleiner Felssporn auf dem das Ödschlössel errichtet wurde. Die beiden Burgruinen liegen etwa 2,5 Kilometer nördlich vom alten deutschen Städtchen Reichenstein, elf Kilometer südlich von Schüttenhofen. Reichenstein ist die höchstgelegene gotische Stadt Böhmens. Heute tragen freilich all diese urdeutschen Stätten eines eingedrungenen fremden Volkes neue Namen. Die Sage „Der Kaiser im Berg“ erzählt, dass in dem Berg unterm Ödschlössel der Kaiser Karl mit seinen Rittern verzaubert säße. Es heißt da: Vor Zeiten rastete einmal ein blutjunger Kaplan auf den Trümmern des Ödschlössels. Da winkte ihm ein Zwerg aus einem verfallenen Gang und führte ihn tief in den Berg hinein, und sie kamen in wunderbare Zimmer, eines war schöner als das andere, dass dem Pfaffen die Augen wehtaten vor lauter Glanz. In einem Zimmer war ein Tisch voller Kuchen und Braten und süßen Wein, dort aß und trank er nach Herzenslust, und auch ein Himmelbett war dort zum Schlafen. Bevor der Zwerg ging, zeigte er ihm ein schwarzverhangenes Fenster und sagte: „Durch das Fenster darfst du nit schauen !“ Wie der Mann aber sich ausgeschlafen hatte, schaute er allweil das schwarze Tuch an, und schließlich konnte er sich vor seiner Neugier nimmer retten, und er schob das Tuch ein wenig weg. Da sah er einen riesigen Saal, drin funkelte es von Gold und Edelsteinen, an der Wand standen eiserne Ritter, und mitten im Saal schlief auf einem goldenen Sessel der uralte Kaiser, und seine schöne Tochter kämmte ihm den weißen Bart, der siebenmal um den Tisch gewachsen war. Wie dem Kaplan vor Schauen die Augen übergingen, stand der Zwerg neben ihm und vertrieb ihn mit wilden Gebärden aus dem Berg. Jetzt ging er nach Bergreichenstein zurück. Aber die Stadt war mit ihren Häusern und Gassen ganz verändert, und in den Gassen gingen lauter fremde Leute auf und ab, und er kannte niemand, und niemand kannte ihn. Und wie er im Pfarrhof nachfragte, so kam er darauf, dass er hundert Jahre im Berg verbracht hatte. Er war auf einmal ein eisgraues krummes Männlein und sank um und starb. (Quelle: Hans Watzlik, „Böhmerwald-Sagen“, 1921)
Unsere Vorfahren kleideten ihr Wissen und Verstehen sehr oft in Lehrerzählungen ein, die uns als Märchen erhalten blieben. So scheint auch das Märchen vom „Hirt am Odenberg“ solch ein Belehrungsmärchen zu sein. Tief im Innern des Kosmos und in jeglichem Ding waltet als Lebenselixier, die Od-Kraft. Das All konnte mit dem Gleichnis des Berges umschrieben werden. Der Odberg ist der Allberg, der Himmelsberg. Deshalb nannte man manche heiligen Anhöhen im weiten Germanien, auf denen die altgläubigen Sippen ihre Opferbräuche für die Od-Gottheiten vollzogen, Odberge. In christlicher Zeit wurden sie gern auf den Wodan-Ersatz, den seelengeleitenden „Erzengel Michael“ umbenannt, denn der Altdeutsche verstand seiner Sprache nach unter dem „Michil“ den Großen, Starken, Gewaltigen, Mächtigen -, also Wodan. Das Volk glaubte, tief im Innern der Odberge würden die Od-Herrscher hausen und Hof halten. Man erzählt, wie der Hirte einmal gewahr wurde, dass eines seiner Tiere die Erde aufwühlte und goldgelben Hafer daraus fraß. Er hatte vorher von seinem Vater gehört, dass solcher Hafer im Berge wachsen würde, damit die Rosse des Herrschers, der darin seit langen Vorzeiten schlafe, nicht verhungerten. Er fand auch wirklich eine Öffnung im Fels und trat, mit seinem Knaben an der Hand, hinein. In einer weiten, mit Schätzen vollgefüllten Halle erblickte er den hohen Herrn mit güldener Krone auf dem Haupt. Der erlaubte dem armen Mann, seine Taschen reichlich zu füllen, so viel er tragen könne. In sieben Jahren zur Mittagsstunde könne er wiederkommen, da stünde erneut der Berg offen. Beim gierigen Einsammeln der Schätze vergaß der Hirt aber sein Kind. Erst als er draußen war, die Türe hart hinter ihm niederfuhr und ihm die Hacke wund schlug, so dass er fürderhin etwas lahmte, gewahrte er seinen Verlust. Er war jetzt reich und satt, aber das Beste, das Lebendige, sein Kind hatte er unter dem „Geldverdienen“ vergessen und verloren. Geht es nicht vielen Menschen zu allen Zeiten so ?! Vergisst man doch über dem Geschäftemachen, Börsengucken, Spekulieren, Goldscheffeln, allzu leicht den Nachwuchs, nämlich das wahre Weiterleben in Kindern und Enkeln.
Auch unser heutiges Deutschland ist voll des toten, kalten Reichtums und verarmt am Lebendigen. Wir vergaßen das Kind, die Kinder. Wir vergaßen, dass wir selbst nur Kinder-Glieder in der Ahnen- und Enkelkette des Lebens sind. Viele von uns „humpeln“ als vermögende, kinderlose Knechte des Mammons dem Grab und dem Vergessen entgegen. Für wen schaffen und raffen eigentlich die Deutschen, wo sie doch viel zu oft ohne die ergänzenden Kinder sind ?! Im Märchen vom Odenberg fand der Mann nach sieben Jahren zurück in den Seelenberg, holte seinen spielenden Knaben wieder nach Hause und war zukünftig vorsichtiger und bedachter. Er hatte über lange Jahre erkennen können was ihm das Wichtigste war, nicht das schnöde Gold und die Glitzersteine, sondern das lebendige Lachen seines Jüngsten. Im Odberg ist alles verborgen, aus ihm ist alles zu gewinnen, die Schätze der Materie und die Schätze des Lebens, vergessen wir das eine über dem anderen nicht ! Das könnte die Lehre der Sage sein. Im Märchen gibt es immer einen glücklichen Ausgang, weil uns damit Mut gemacht werden soll, den rechten Weg zu gehen. Doch die Wirklichkeit sieht nicht selten viel trostloser aus.
Es gibt aber auch ein faszinierendes Beispiel für die vitale Zähigkeit mit der sich Sippenleben zu erhalten weiß. Sie waren wahrhaftig in alten Zeiten vorhanden, die Totenberge, aus denen heraus man die Reinkarnation der Verstorbenen erhoffte. Nicht allein die künstlich und fleißig aufgetürmten kleineren und größeren Totenhügel. Man glaubte fest an die Wiederkunft, an den ewigen, großen Kreislauf des Seienden, wie ihn das Naturgeschehen in jedem Jahr aufs Neue eindringlich demonstriert. Eine im Südharz überlieferte Sage scheint direkten Bezug auf den Höhlenfriedhof des Berges Lichtenstein zu nehmen. Es ist von Menschen die Rede, die in einer Berghöhle wohnen und eines Tages ins Tal hinab ziehen würden, um ein Fest mit den dortigen Leuten zu feiern. Bei dem Harz-Städtchen Osterrode, im Berg Lichtenstein, dehnt sich die enge, 115 m lange Rotkamphöhle. Hier fanden Archäologen Hinweise, dass es sich um eine bronzezeitliche Kult- und Opferstätte handelt. Anfangs ging die makabre Phantasie einiger Zeitgenossen davon aus, die dort gefundenen Skelette würden von mutwillig hinab gestürzten, also geopferten Menschen herrühren, mittlerweile ist erkannt, dass die Höhle vor ca. 3.000 Jahren als sakraler Begräbnisort genutzt worden ist. Nach den neuesten Erkenntnissen sind 65 bis 70 Verstorbene der „Urnenfelderkultur“ in der Höhle niedergelegt worden. Auch fand sich ein Grabbeigaben-Depot von Bronzeschmuck. Den Wissenschaftlern gelang es, Erbgutanalysen der gefundenen Knochen zu erstellen. Sie verglichen diese Ergebnisse mit den DNA-Mustern von noch heute im westlichen Harz-Gebiet lebenden Einwohnern. Das schier Unglaubliche trat ein, die vor 3.000 Jahren beerdigten Harzbewohner besitzen bis zum heutigen Tage über 100 Familienangehörige im gleichen Bezirk. Über 120 Generationen hinweg reicht der lebendig gebliebene Blutstrom und ist demzufolge der bisher längste genetisch belegbare Stammbaum der Menschheitsgeschichte.
Das alte Germanien, so scheint es, war überzogen von einem Netz solcher Plätze, die anhand ihres Namens absolut sicher, andere mit einiger Wahrscheinlichkeit als Kultorte der altheimischen Religion gedeutet werden können. Etlichen davon ist auch heute noch, selbst nach langen Jahrhunderten fremdgläubiger Überlagerung, das Geheimnis ihrer Urbestimmung zu entlocken. Ein Ortsteil von Remagen, dem keltischen Ricomagus („Königsfeld“), ist Oedingen. Wenige Kilometer östlich fand man den Basisstein eines röm. Jupiterdenkmals. Westlich davon gibt es ein Odesheim. Nahe bei, also südlich Bonn, liegen Bad-Godesberg, Gudenau und Odendorf, das als Odigedorp in der Chronik des Bonner Cassiusstiftes um 800 erwähnt wird. Seine Ortskirche ist eine der ältesten im Rheinland. Die vorbestehende Gerichtsstätte wurde von frühen Missionaren in ein Heiligtum für den „Erzengel Michael“ umgewandelt, der so oft als Wodanersatz fungierte. Die heutige Ruine der Godesburg (siehe Abb.) bei Bad Godesberg - urkundlich auch Wudinsberg / Gudinsberg - steht auf einem steilen erloschenen Vulkan. Als Kultstätte der germanischen Ubier ist der Berg 722 unter dem Namen Woudensberg erwähnt worden. Dort befindet sich eine Michaelskapelle, wie es bei einem Wodanheiligtum zu erwarten ist. Jener Anteil der durch den röm. Statthalter Agrippa umgesiedelten Ubier wurde Agrippinenser genannt, ihr Hauptort hieß Ara oder „Oppidum Ubiorum“, das von den Römern in „Colonia Claudia Ara Agrippinensium“ umgetauft, schließlich zu Köln wurde. Eine ganz frühe Besiedelung dieses Raumes beweist der „Fritzdorfer Becher“ aus 1.500 v.0. Hier fanden sich Gräber der fränkischen Siedler des 5. Jhs., nach deren Landeinteilung dieser Bezirk nördlich der Aarmündung in den Rhein, auf der Grenze von Ebene und Eifel, als Odangau bezeichnet wurde.

Der Ort Oedekoven bei Bonn hieß 795 noch Odenkoven (ein Hof mit reichem Landbesitz). Ein ahnungsarmer Professor deutet den Ortsnamen als ein Odinghova bzw. als einen „Hof der Leute des Odo“, oder eines Otbert, welcher um das Jahr 795 als Stammvater der „Pfalzgrafen bei Rhein“, der Ezzonen, lebte und in der Gemarkung Oedekoven angesiedelt war. Doch auffällig und aufschlussreich wird uns beim Studium der Region, dass nur ca. 12 km entfernt, südlich von Brühl, die Ansiedlung Walberberg liegt, die 962 in einer Schenkungsurkunde des Erzbischofs Brun von Köln als „Berche“ erscheint und auch heute noch im Volksmund „Berech“, nhd. Berge / Berg heißt. Brun verschenke zwei landwirtschaftliche Güter bzw. „Hufe“ von dort, weitere in Guntheresthorp, an das „Damenstift der hl. Cäcilia in Köln“. Der Ortsname Walberberg wurde erstmals als „mons sanctae walburgis“ („Berg der heiligen Walburga“) 1118 urkundlich in den „Annales Rodenses“ erwähnt, wo es um die Schenkung eines dortigen Weinberges an die Abtei Klosterrath ging. In den Jahren 1193-1205 hat man auch ein Nonnenkloster „Walberberg“ gegründet. Immer wieder ist festzustellen, dass altheilige Bezirke Klosterbefugnissen überantwortet wurden. Wie kam es nun, dass einflussreiche Kleriker aus dem „Berg“ einen „Walburgisberg“ manipulierten ? In Uedorf (1143 Oclichtorph, 1261 Odorp, 1336 Oydorp, 1413 Oedorp, 1542 Udorp), zum nahen Bornheim gehörend, hat man einen Matronenstein gefunden, der den kelt.-germ. Mütterkult auch für den Bonngau („Pagus Bonnensis“) nachweist. Der urmutterkultisch geprägten Bevölkerung in diesem Raum sollten neue christliche Ausrichtungen eingepflanzt werden. Die vielen Nonnenklöster der Region lassen sich als Fortführungen altheidnischer Traditionen erahnen. Der gallogerm. Matronenkult war eine Verehrungsform von Muttergottheiten, den Matronen, eng verwoben mit dem Glauben an Disen, Nornen, Walküren. Bornheim liegt auf halber bzw. jeweils kurzer Wegstrecke zwischen den alten Siedlungen Odenkoven und Berche (Walber-Berg). Wie altbedeutsam der Platz war, ersieht man daran, dass im Bornheimer Ortsteil Waldorf der „Dingstuhl“, d.h. der Gerichtsstuhl, die Gerichtsstätte für die umliegenden Ortschaften war. Das alte Schöffensiegel Waldorfs von 1380 trägt das Flammenschwert als Attribut des Pfarrpatrons von Waldorf, des „St. Michael“. Keltische, germanische Fliehburgen befinden sich in der Umgebung, wie die Aldeburg mit Ringwallanlage, eine Höhenburg im Walberberger Wald und die Rheindorfer Burg. Diese Höhen nutzte die dortige Bevölkerung in ihrer Urfrömmigkeit offensichtlich als Kultorte in ihren Andachten für „die Mütter“ und für Wodan. Erst auf Veranlassung des skrupellosen und verhassten Erzbischofs Hanno II. (1010-1075) wurden Leichenteile von der Äbtissin Walburga („Reliquienkult“) i.J. 1069 vom Kloster Eihstat / Eichstätt im Altmühltal nach Berch überführt. Es handelte sich um einen Teil ihrer Hirnschale und sechs Stücke ihres Stabes. Hanno war ein machtlüsterner Bursche, dessen Untaten wie Kindesentführung von Heinrich IV., Diebstahl der Reichskleinodien und Mordterror mit bewaffneten Söldnern gegen die Kölner Bürger - die ihn i.J. 1074 gern verjagt hätten - ihm schließlich sogar die Heiligsprechung durch die katholische Kirche bescherte. Er hatte es so weit getrieben, dass 600 Kaufleute die Stadt verließen. Nach Bericht von „Lampert von Hersfeld“ „war die Stadt fast völlig verödet und schauriges Schweigen herrschte auf den leeren Straßen“. Die „St.-Walburga-Kirche“ von Walberberg ist eine ehemalige Klosterkirche der Zisterzienserinnen des 12. Jhs. Für die Betreuung der bald einsetzenden Walburga-Wallfahrten wurde ein Klerikerkonvent angebaut. Am Beispiel von Walberberg wird klar ersichtlich, wie der Walburga-Kult einer urfrömmigen Region künstlich aufgepfropft wurde. Aus der angelsächsischen Missionarin Walburga (um 710-779) haben Kleriker einen Muttergottes-Ersatz manipuliert. Dazu bot sich insbesondere bereits der Name Walburga an: ahd. wala, mhd. waleheit, wolheit, nhd. Wohl / Vermögen -, verbunden mit ahd. bergan, nhd. bergen / verwahren / schützen / tragen. Die Völva oder Wala war der altnordische Begriff für eine heidische Seherin, Prophetin, Schamanin und bedeutet „Frau mit Stab“. So wird die Walburga auch als Stabträgerin, im altheiligen Sinne, Aufnahme bei den missionierten Menschen gefunden haben.
Das etwas südlich von Bonn liegende Bad Godesberg wurde in mittelalterlichen Urkunden Gudenesberg, zuvor Wodenesberg geheißen. Nur ca. 60 km Luftlinie östlich, im Lahn-Dill-Kreis, liegt als höchstgelegener Ort unter den Nachbargemeinden, Odersberg. In dessen Nähe, südlich von Herborn, befindet sich die Siedlung Edingen an der Dill, 1341 hieß sie noch Ödingen. Sie liegt unterhalb bzw. östlich von Ort und Burg Greifenstein im Westerwald. Ettlingen in Baden-Württemberg wurde 788 als Ediningom in einer Urkunde des Klosters Weißenburg im Elsaß geführt, es könnte mithin aus einer allamannischen Siedlung namens Odin-ingom hervorgegangen sein. Ein Edingen-Neckarhausen liegt am Neckar zwischen Mannheim u. Heidelberg. Es wurde 765 in einer Schenkungsurkunde des Klostern Lorsch erwähnt. An der Lahn liegen Odenhausen, ein Odersbach bei Weilburg, nördlich davon wiederum ein Odersberg. Nordöstlich von Gießen ist Odernhausen. Östlich von Osterode im Oberharz liegen bei Sankt Andreasberg der „Kleine Oderberg“ (685,1 m) und der südlich gelegene „Große Oderberg“ (649,6 m), dessen Ostflanke zum Flüsschen Oder abfällt. Etwas westlich von Kassel liegt das Dorf Altenstädt, das gemäß einer Klosterurkunde von 831 Alahstat hieß, ein Begriff der ahd. die Weihestätte bedeutet (got. alhs, ahd. alah fanum = Tempelstätte). Es befinden sich Ödinghausen nordwestlich von Gudensberg am eingangs beschriebenen Odenberg südlich von Kassel. Im 10. Jh. gab es den „Hof Wodensberg in Gudenberg“, laut Urkunden. Textliche Erwähnungen: 1121 Uudenesberc, 1154 Wuodenberg, 1672 Wutansberg, bis ins späte 17. Jh. Wodenesberg. Eine kleine Wegstrecke südlich von Gudensberg erhebt sich der Maderstein, eine aus der Mader-Heide jäh aufragende Basaltkuppe. Am Rande der nahen Siedlung Maden steht ein Malstein, „Wotanstein“ genannt, welcher einstmals, von fernher geholt, hier am Ort der Kult- und Eidstätte aufgestellt worden ist. Die Löcher in dem ca. 2 m hohen Quarzit sollen der Sage nach von den Krallen des „Teufels“ herrühren, der den Felsbrocken allzu gern auf die erste Christenkirche im ca. 15 km entfernten Fritzlar geworfen hätte, die der katholische Papstagent Bonifaz(ius) aus dem Holz der heiligen Donareiche errichten ließ. Diese soll, etwas vom Dorf Altgeismar entfernt, auf dem heutigen Domplatz zu Fritzlar gestanden haben. Die frevelhafte Naturzerstörung, zu Gunsten eines fanatisch eingepeitschten puren Hirnproduktes, dürfte bezeichnend sein für die skrupellos vorangebrachte Christenmission. Hier in der Kernlandschaft des chattischen bzw. hessischen Stammes lag dessen Hauptvolksburg Mattium, die die Römer i.J. 15 überfielen und niederbrannten. Bei der westlich von Gudensberg liegenden Siedlung Metze (800 Metue, 1074 Metzihe, 1081 Mezehe) ist sie zu vermuten. Auf der Maderheide, unterhalb des Gottesberges, wurden die hessischen Thing-Versammlungen abgehalten, auf denen noch im Hochmittelalter die Gaugrafen Gericht hielten und den Heerbann ausriefen. In einer Urkunde aus dem Jahre 1324 wird Gundensberg als die „Hauptstadt von Nyderlandt zu Hessen“ bezeichnet. Der nördlichste Stadtteil von Gudensberg ist Dissen (1061 Dusinum), wohl nach den heiligen Frauen, den Feen und Nymphen des alten Glaubens benannt, den Disen, Idisen. Der Sonneborn (1495 Soenborn), eine ergiebige Quelle zwischen Dissen und Gudensberg, spendete seine Wasser den im Mittelalter verwüsteten Siedlungen Unseligendissen und Mitteldissen. Die zuerst genannte weist uns auf die kirchlicherseits verunholdeten Disen (Hagdisen = Waldfräulein / Hexen) hin, die auch im Begriff einer Gemeinde nördlich der Höhenzüge des Teutoburger Waldes, Bechterdissen, klarer zu Tage treten, als die Priesterinnen der germ. Gottesmutter Bechta. Dieser Beiname der Göttin Frija weist sie als die Helle / Strahlende aus. Der Kern von Ubbedissen wird auch Frordissen genannt und der nördliche Bereich auch Dingerdissen. Der Begriff Frordissen dürfte aus den „Disen des Fruchtbarkeitsgottes“ ahd. Frô, altnord. Freyr verstanden werden. Unseligendissen könnte ebenso auf heidnische Gräberfelder am Fuße des Odenberges hindeuten. Naheliegend ist, dass 1357 eine besitzende Sippe ihre Ländereien zu Gudensberg-Kirch-Dissen dem Kloster der Zisterzienserinnen möglicherweise nur deshalb verschenkte, um einen vermeintlichen Fluch aus altgläubigen Zeiten zu tilgen. Ein weiterer Ort „Dissen am Teutoburger Wald“ wurde 822 erstmals urkundlich erwähnt, als „Ludwig der Fromme“ den Meierhof in Dissen an den Bischof von Osnabrück verschenkte. Auf den germ. Disenkult weist der hochmittelalterliche Begriff Disting hin - von Disaðing abgeleitet - für die Februar-Versammlung, was „Thing zum Zeitpunkt des Disen-Opfers“ bedeutet. Ortsnamen in Schweden sind Diseberg, Disevid, Disasen, Disaðing -, in Norwegen: Disin, früher Disavin (Disenwiese). In heidnischer Zeit flossen die verschiedenen sakralen Frauenwesen mit den Disen zusammen, so dass die Bezeichnung Disen zum Oberbegriff für alle mythologischen bzw. heiligen Frauen wurde. So nannte man in altnord. Texten die gemeingerm. Muttergöttin altnord. Freia / Freyja, südgerm. und ahd. Frija / Frea die „Vana-Dis“. Nahe der Kleinstadt Diessenhofen am Rhein, in der Gemeinde des Bezirks Frauenfeld des Schweizer Kantons Thurgau, befand sich wenige hundert Meter westlich das Kloster St. Katharinental der Dominikanerinnen und noch etwas weiter, das Kloster Paradies der Klarissen. Die Stadt Frauenfeld liegt um 20 km südlich.In einer Urkunde aus 1246 wurde der Namen eines Ritters „B. von Vrowinvelt“ genannt. Ebenso im 13. Jh. erschien erstmals der Name Diessinhovin, von dem anzunehmen ist, dass er sich auf einen „heiligen Hof“ (germ. Begriff für Tempel) des gallogerm. Mütterkultes der Disen bezog, obwohl die früheste erhaltene urkundliche Erwähnung des alemannischen Weilers im Jahr 757 als Deozincova und 839 als Theozinhovun erwähnt wurde. Ein Priester namens Lazarus hat sie dem Kloster St. Gallen geschenkt. Immer wieder treffen wir die gleichen historischen Sachverhalte an, kirchlichen Agenten wurden altheidnische Stätten von weltlichen Machthabern übereignet, um sie im kirchenchristlichen Sinne zu bearbeiten bzw. zu „entdämonisieren“ und wurden im weiteren Verlauf den personell und verwaltungstechnisch dafür gerüsteten klösterlichen Großunternehmen verschenkt. Anzunehmen ist, der sich in den Besitz der Disen-Weihestätte gesetzte Priester wollte den heidnischen Begriff der Disen nicht gebrachen und formte ihn um zu „Deozin“, woraus Kirchenleute später ihr „Thedozin“ formten. Die heute angebotene willkürliche sprachliche Erklärung, der Name würde sich möglicherweise ableiten von „bei den Höfen des Die(o)zzo“, geht am Gesamtbefund, hinsichtlich des Bezirks Frauenfeld sowie der sich dort ansiedelnden Frauenklöstern, vorbei und ist mithin abzulehnen.

Eine kurze Strecke südöstlich von Gudensberg, dem althessischen Gaugrafenzentrum, liegt die Ortschaft Felsberg, die „Drei-Burgen-Stadt“. Sie wird von der Eder durchflossen, welche in ihrem jungen Oberlauf bei Berleburg von der Odeborn gespeist wird. Die schon eiszeitliche Besiedelung der Region ist durch den 12.000 Jahre alten Fund des Schädels von Rhünda belegt. Im Umfeld der Stadt erhoben sich einstmals drei herrliche Burgen: die Felsburg (1090 Velisberc), die Altenburg (1322 Aldinberg) mit ihrem noch heute hohen, schlanken Bergfried, und auf dem anderen Ederufer die Burg Heiligenberg. (Abb. Felsberg in Mitte, Heiligenberg rechts, von M. Merian d.J., 1655) Eine uralte Besiedelung und Nutzung der wehrhaften Höhenlage durch eine Wallburg ist schon für Jahrhunderte vor der Zeitrechnung bezeugt. Der röm. Historiker Tacitus erzählt in seiner „Germania“ von den Chatten, sie verfügten über feste Körper, sehnige Glieder, einen regsamen Geist mit Organisationstalent und diszipliniertem Verhalten. Eine gewisse Anzahl ihrer Jungmannschaft weihte sich ganz der Landesverteidigung, sie ließen Haupt- und Barthaar so langte völlig ungebändigt wachsen, bis sie einen Feind überwunden hätten, dann erst würden sie sich die Haartracht abschneiden und verkünden, sie hätten sich nun ihres Stammes und ihrer Eltern würdig erwiesen, gewissermaßen dadurch ihre Geburt erst bezahlt. Berufsmäßige Krieger blieben ehelos, wurden von der Gemeinschaft unterhalten und demonstrierten ihre Zugehörigkeit zur Truppe durch das Tragen eines Eisenringes, den sie, zusammen mit der wilden Haartracht, ihr gesamtes Leben über nicht ablegten. Die griech.-röm. Historiker berichten von einer gefangenen chattischen Priesterin namens Libes, auch von chattischen Fürsten namens Arp(us) und Ucromir(us) und einer adligen Tochter Rhamis. Sie sind beim Triumphzug des röm. Feldherrn Nero Claudius im Jahre 17 n.0 als Gefangene der röm. Stadtbevölkerung vorgeführt wurden. Schlimm hauste mit seiner Soldateska der Sohn des Drusus hier im Hessenland. Doch Kaiser Tiberius sprach auch von eigenen entsetzlichen Verlusten während der Terrorzüge durch Germanien.
Schauen wir vom Godesberg und Heiligenberg, wo möglicherweise die altgläubige Priesterin Libes in einem heiligen Hain ihren Dienst verrichtete, nach Osten ins oberhessische Bergland. Dort ragt ein weiterer bedeutungsvoller Stauf. Der echte urkundliche Name aus 1195 des „Hohen Meißners“ (753,6 m) lautet „Wissener“, was von ahd. „wizon“ = „Weissager“ zu erklären wäre. Der Name „Meißner“ wird in Akten der landgräflich-hessischen Verwaltung erstmals 1530 erwähnt. Auch das nördlich gelegene Witzenhausenim Werra-Meißner-Kreis trägt diesen Begriff, der sich nur auf das alte Weistum beziehen kann, welches, wie es die Alten meinten, hier zuhause war. Nicht weit südöstlich liegt Wahlhausen (Lkr. Eichsfeld), die Gemeinde im Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen wurde schon 780 erwähnt, als der Frankenkönig Karl die Sachsen unterwarf. Die erste Namensschreibung war Waldesa, was als Wald-Asa - „Asisches Waldheiligtum“ - zu erklären wäre. Wir hören über diesen germ.-altdt. Gottesbegriff später mehr. 1336 wird der Ort auch Wasser-Waldesa genannt, denn der Ort liegt an der Einmündung des Flüsschens Walse in die Werra. Die Region des „Hohen Meißners“ gilt als Heimat der Legenden um „Frau Holle“, der germ. Muttergöttin, die unter dem Deckmantel dieser Märchengestalt weiterlebt. Auf seinem Bergmassiv schweigt der sagenumwobene, verträumte Hollenteich(heute: Frau-Holle-Teich) in den Himmel hinauf. Er soll, den örtlichen Sagen nach, bodenlos und der Eingang in Urmutters Anderswelt sein. Landgraf Hermann von Hessen-Rotenburg beschrieb 1641 heutigen Wissens nach als erster das Stillgewässer des Hollenteichs, wobei er mehrere Holle-Sagen erwähnte. Es war Glaube, dass aus dem Hollenteich die kleinen Kinder kommen und die Seelen der Verstorbenen in seine Tiefen zurückfahren würden. Auch war es Brauch, dass junge Frauen in diesem Teich badeten, wenn sie ein Kindlein zu empfangen hofften. Das Andenken der „Frau Holle“ und „der Holden“ erhielt sich nicht allein in hessisch-thüringischen Gauen. Hollen (10. Jh. Holanla) ist Ortsteil in der Gemeinde Uplengen (Lkr. Leer, Ostfriesland). Ein Hollen, schon 1004 genannt, gehört zu Hollnseth (Lkr. Cuxhaven), die „Hollener Möhl“ ist eine dortige Wassermühle. Ein Hollen bei Eydelstedt liegt im Süden von Bremen, ein anderes südlich Bremerhaven. Selbst in der ostfriesischen Geest (Lkr.Ammerland) gibt es ein Hollen und im Hullenmoor die kleine Kolonie Hullenhausen. Im Umfeld von Hollen und der „Hollener Höhe“ bei Großenkneten (Lkr. Oldenburg) sind zahlreiche Hünengräber der Großsteingräberleute erhalten, so dass das Bild eines Megalithgrabes im Ortswappen Aufnahme fand. Ein Hollen liegt im Reg. Bezirk Düsseldorf (Lkr. Kleve) bei Uedem, das im 7. Jh. schon stark besiedelt war. Urkundliche Erwähnung erfolgte 836 als „in Odeheimero marca"; in weiteren Quellen: Odeheimero, Uodheim, Udem, Uodem, Uedem, Oedeheym, Othehem. Amüsant ist wieder, dass offiziell ein Herr Udo als Gründer angenommen wird. Die Einwohner in und um Hollen im Saterland (Lkr. Cloppenburg) gehören zur saterfriesischen Sprachminderheit. Ein Hollen ist Teil der niedersächsischen Gemeinde Martfeld (Lkr. Diepholz). Martfeld liegt südlich von Verden an der Aller, der Stätte des Massenmordes an den sächsischen Freiheitskämpfern durch „Karl den Großen“, es wurde 1179 in einer päpstlichen Urkunde erwähnt, die Alexander III. persönlich unterschrieb. Sein Name wäre folglich aus Mord- oder Marterfeld zu erklären. Es ist, westlich der Weser, nur ca. 12 km von Verden entfernt. Ein Otersen, südlich von Verden, liegt östlich an einer Aller-Schleife, mitten in einem Waldgebiet. Hollen, als nördlicher Stadtteil von Gütersloh, liegt südlich nahe bei Marienfeld, am Lichtebach, welcher im Bielefelder Ortsteil Quelle (1221: Cawelle) am Südhang des Hünenbergs, auf dem einst die Hünenburg stand, entspringt. Die Ruine der oberfränkischen Amtsburg Hollenberg (Lkr. Bayreuth) liegt auf einer Bergkuppe über dem Weiler Hollenberg inmitten des Hollenberger Waldes. Zwei Hollen-Orte liegen bei Seegund Rückholz im schwäbischen Landkreis Ostallgäu.
So wie der Name „Holle“ die erhoffte gedeihliche Huld der Göttin ausdrückte, beschrieb ihr Name „Bechta“ die strahlende Reinheit ihrer Erscheinung. Ein Ort Bechtheim liegt im Untertaunus, dessen früheste Schreibweise 1306 Bechtheym lautete. Er gilt als echter „Heim-Ort“, d.h. er wurde gegründet in der ersten fränkischen Besiedelungsphase nach der Schlacht von Zülpich 496. Zu diesem Zeitpunkt waren die Franken noch Heiden und huldigten auch ihrer Gottesmutter Bechta (Bechte / Berte / Perhta / Perahta von ahd. „beraht“ = die Glänzende), nach welcher der Ortsname zu deuten ist. Allerdings findet heute die fränkische These hinsichtlich der „Heim-Orte“ keine ungeteilte Zustimmung mehr. Der Ortsnamensforscher G. Müller meint: „Als die Franken ihren Einfluss in Hessen geltend machen konnten, muss hausen dort, in Niedersachsen und in Ostwestfalen schon ein bestimmendes Element der Namenlandschaft gewesen sein.“ Das weitere Bechtheim, sog. „Kleinod im Wonnegau“, ist eine Gemeinde nördlich von Worms, die angeblich ein fränkischer Edelmann namens Bero im 6. Jh. als „Beroheim“ gegründet haben soll, aber der Gemeindename war 817 Berthahem, 1193 Berthehem (Ernst Förstemann, „Altdeutsches Namenbuch“, 2 Bde., 1856/59). Vom Begriff her entspricht die germ. Bechta der kelt. Borbeth. Die altheiligen Drei-Mütter finden wir durch über 400 Matronen-Denkmäler im gallo-germanisch besiedelten Rheintalgebiet - bis zum Odenwald hin - aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung belegt. Im Volksmund hieß man sie die „drei Bethen“ Ambeth (Erdmutter), Wilbeth (Mondmutter), Borbeth (Sonnenmutter). Christliche Wandlungskünstler änderten sie in „drei heiligen Madl’n“ und „drei Marien“, wie wir sie in einer Seitenkapelle des Wormser Domes als fein gearbeitete Steinskulpturen bewundern können. Der Wormser Bischof Burkhard sah sich noch um 1020 in seinem „Bußspiegel“ genötigt, zu wettern: „Den drei Schwestern soll man nicht opfern oder zu ihnen beten.“ Eine der von diesem Kleriker vorformulierten Beichtfragen lautete: „Hast du getan, was manche Weiber zu gewissen Jahreszeiten zu tun pflegen, dass du in deinem Hause darauf zurüstetest, damit wenn jene drei Schwestern kämen, sie sich laben könnten ?“ Eine andere Beichtfrage war: „Hast du die Überlieferungen der Heiden beobachtet, die sich bis auf den heutigen Tag von Vater auf Sohn gleichsam erblich fortpflanzen…“ In den folgenden Jahrhunderten erschien in der kirchlichen Literatur Deutschlands und Frankreichs immer wieder die bewegte Klage darüber, dass ein Drittel des Volkes noch immer dem Heidentum anhinge. Worms selbst war in gallogerm. Zeit wohl ein bedeutender Mutterkultort namens Borbetomagus (Feld der Borbet). Im Christentum wurde die Borbeth auch zur hl. Barbara umfunktioniert. Gleichzeitig hat man die heidnische Bechta verteufelt bzw. zur Unholdin verhext.
Um 50 km Luftlinie östlich von Worms liegt die „Veste Otzberg“ am Nordrand des Odenwaldes. Es handelt sich um eine befestigten Basaltkuppe, bei der kleinen Gemeinde Hering, Landkreis Darmstadt-Dieburg. Im Osten liegt die Gemeinde Höchst im Odenwaldkreis. Der Siedlungsraum ist seit der Jungsteinzeit (5.500 bis 2.500 v.0) bis in die Hochzeit der Keltenperiode (500 v.0), der römischen Besatzungszeit (bis 260 n.0) und germanischen Landnahmephase (ab 3. Jh.) kontinuierlich bewohnt. Dass es sich beim Otzberg um eine altheilige Od-Weihestätte des Wodan Kultes handelt, geht aus den ursprünglichen Bezeichnungen hervor: 1231: „castrum Othesberg“, 1244: „castellano de odesbrech“, 1374: „Otsperg die burg“, 1690: „Utzberg“/„Otzberg“. Üblicherweise wurden die alten Hauptweihestätten der Volksreligion von den karolingischen Behörden in die Verwaltungshände der reichsunmittelbaren Klöster gelegt, um die dortigen Umerziehungsmaßnahmen an der Bevölkerung vorzunehmen. So geschah es auch mit dem Otzberg, welcher dem nordhessischen Kloster Fulda übereignet worden ist. Der fränkisch-karolingische Hausmeier Pippin der Jüngere (714-768), ab 751 König der Franken und Vater „Karls des Großen“, schenkte den Otzberg, der zum karolingischen Königshof „villa autmundistat“ gehörte, im Jahre 766, „mit Zubehör“, der Reichabtei Fulda. Anfang 14. Jts. gingen dem Kloster Fulda die Mittel aus, deshalb verpfändete Fürstabt Heinrich VI. von Hohenberg im Jahre 1332 die „Veste Otzberg“, sowie den fuldischen Anteil von Umstadt, an einen Werner von Anevelt und Engelhard von Frankenstein, die auf dem Otzberg neue Bauten ausführen ließen. Bestätigt wurde das Rechtsgeschäft vom Mainzer Erzbischof Siegfried III. (1194-1249), gleichzeitig Verwalter der Abtei Fulda, war zugleich Landesherr des Erzstiftes und der Kirchenprovinz Mainz, dazu „Erzkanzler in Germanien und Kurfürst des Heiligen Römischen Reichs“. Der altheilige Otzberg/Od-Berg liegt um 10 km nördlich der Gemeinde Mümeling-Grumbach, die ihre Zusatzbezeichnung vom Fluss Mümling entnahm (frühere Schreibweisen, 798: Mimelinga, 1012: Minimingaha). In der alten Grumbacher Friedhofsmauer war ein Dreimütter- oder Matronen-Relief eingemauert, ungefähr 1,25 m x 1,15 m groß. Man brachte es in das Innere der dortigen Bergkapelle, nicht ohne das Gesicht der mittleren Göttin zu zerstören (wenn es nicht schon vorher geschah), in der Annahme, es handle sich um eine Heidin, während ihre beiden sie flankierenden Frauen, wegen deren Turbane, die als christliche Heiligenscheine missdeutet wurden, unversehrt blieben. Man liest dazu: „1841 hat ihn der Erbacher Archivrat Christian Kehrer in der benachbarten Friedhofsmauer entdeckt. Aber die Entdecker deuteten den Stein um. Die halbkreisförmige Kopfbedeckung der drei Matronen erschien ihnen als der Heiligenschein der drei Heiligen aus dem Morgenland.“ Als Sinnzeichen ihrer Funktionen als Fruchtbarkeitsbringerinnen hält jede einen Korb mit Früchten im Schoß. Eine Rekonstruktion des Reliefs kann man auf dem Gelände des wenige Kilometer entfernten „Gutshofes Haselburg“ (röm. „Villa Haselburg“) beschauen. Vom Otzberg aus sind es dorthin nur 8 km. Die Haselburg soll die größte der bürgerlichen Niederlassungen sein, die man bis jetzt im Odenwalde kennt. Bis zum Jahr 1886 ist sie irrtümlich für ein großes Kastell angesehen worden. Das bei der Haselburg eingemauerte, nachgebildete Matronen- oder Nymphenbild ist auf Betreiben des Haselburg-Vereins mit einem rekonstruierten Gesichtsbild versehen worden. Interessant ist, dass auf dem Gelände der Haselburg ein Frauengrab mit reichen Beigaben gefunden worden, das aus einer früheren keltischen Besiedlungsschicht herrührt. Der weit verbreitete Mutterkult hat untilgbare Spuren hinterlassen, in Form von Bodenfunden und von Ortsnamen. Die schon erwähnten heiligen Mütter sind in allen indogermanischen Kulturen nachweisbar, als griechische Moiren, lateinische Parzen und als germanische Nornen. Die Letztgenannten, die Hauptnornen, bezeichnet die Edda als Urd, Werdandi und Skuld, welche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft repräsentieren. Nach dem Mythos sitzen sie am Fuße des Weltenbaums, am Brunnen der Urd. Mit ihren Spindeln spinnen sie auch die Schicksalsfäden ihrer Menschenkinder, indem sie Länge und Dicke sowie das hineingewobene Glück und Leid bestimmen. Sie sind die Herrinnen über Leben und Tod. In aller belebten Welt sind ihre Mitgöttinnen und Gehilfinnen tätig, die Disen, von denen beispielsweise der „1. Merseburger Zauberspruch“ berichtet. Der Disen-Begriff hat sich auch hier im Odenwald, im Ortsteil von Höchst i.O., in der Namensform von Dusenbach (1305: Düsmbach) erhalten. In den Lautformen von Disen, Dasen, Dusen trifft sie der suchende Forscher immer wieder an.
In etlichen Regionen kannte man die drei Mütter als „drei Beten“: Wilbeth, Bilbeth, Fürbeth, oder Anbeth, Ainbeth, Einbeth und Borbeth, Worbeth, Gwerbeth. Im Verlauf der Christianisierung bemühte sich die Kirche den Mutterkult ins eigne Konzept zu integrieren und adoptierte bis ins Jahr 1968 die altheidnischen Mütter, unter dem Namen „die drei Marien“, als eigene Kultheilige. Aus der Wilbeth wurde die „hl. Katharina“, aus der Anbeth die „hl. Anna“ oder „hl. Margarethe“ und, aus der Borbeth wurde die „hl. Barbara“. Auch unter der Bezeichnung „Anna selbdritt“ versuchte die listenreiche Kirche die altgläubige Volksreligion abzupuffern. In der christenkirchlichen Ikonographie verstand man darunter eine Darstellung der „hl. Anna“ mit Tochter „hl. Maria“, mit dem „hl. Jesuskind“ zwischen beiden Frauen. Ein weiterer Übernameversuch geschah mittels der Propaganda für die „Drei heiligen Frauen“ oder „Drei Jungfrauen“: Fides, Spes und Caritas (Glaube, Hoffnung, Liebe). Doch auch die längsten christenkirchlichen Lügenbeine sind einmal abgelaufen und als solche erkannt. Schon beginnen erweckte, junge Frauen sich ihrer altheiligen Würde zu besinnen und die christliche Frauenunterdrückung, mit dem ganzen Wust von Täuschung und Verdrehung, abzuschütteln. Die alte Göttin lebt bis heute in verschleierter Art und Weise weiter: In der „Dreikönigsnacht“ welche im obersteirischen Volksmunde die „Perchtlnacht“ genannt wird, zieht die Frau Perchtl/Bechta um und wandert über Berg und Tal. Zuweilen erscheint sie in Gestalt einer schönen Dame; man erkennt sie dann nur an ihrer langen Nase. Der Ort Bechtolsheim liegt am Fuße des Petersberges (Lkr. Alzey-Worms). Sein Name war 793 Beralfesheim, 798 Beratwolfesheim, 800 Badolfesheim. Nach diesem Befund wäre möglicherweise ein Berat-Wolf bzw. Lichtwolf als Gründerwesen zu konstatieren, ob sich hinter diesem Kultnamen nicht doch eine altgläubige Gottheit versteckt ?! Ein Sprung von Süd- nach Nordhessen: Bei Berfa, nahe Alsfeld im Schwalm-Eder-Kreis, gibt es den Bechtelsberg, der als hessischer Blocksberg, also Hexentanzberg bekannt ist. Etwas nördlich vom alten Kultberg liegt Ottrau, das 775 erstmals in einer Urkunde des Klosters Hersfeld genannt wird; im 9. Jh. hieß es Otraho, 1057 Otheraba, 11. Jh. Ottraha, 1232 Ottra, um 1660 Ottrauw. Nahe der Bechtelsbergkuppe senkt sich eine kesselförmige Vertiefung, die „Hexenkaute“, auch Silberkaute genannt. Hier wird in der Nacht zum 1. Mai großes Gastgebot und Hexentanz gehalten, wie es in den tradierten Erzählungen heißt. Od-Kult und Mutterkult scheinen auch in den noch heute erkennbaren räumlichen Nachweisen, untrennbar gewesen zu sein.

Wir hörten es schon, bei Oberelsungen, nordwestlich von Gudensberg, gibt es den „Kleinen-“ und den „Großen Gudenberg“. Noch weiter, in Richtung Paderborn, liegt Warburg, bei der das Gohgerichtoder Gowgericht, die Thingversammlung der freien Sachsen, tagte. Im Ortsteil Wormeln trat späterhin das Femegericht zusammen. Die markanteste Erhebung in der Warburger Börde ist der Desenberg mit seiner Höhenburgruine (Abb. von J.G. Rudolphi, 1672), zwischen den Orten Warburg und Daseburg. Eine Drachentötersage ist hier zuhause. Am Fuße des Desenberges hauste vor langer Zeit ein Drache der das Land verheerte und vorbeikommende Menschen und Tiere auffraß. Der Kaiser ließ verkünden, wer den Drachen besiegen könne, der bekäme zum Lohn rings das Land um den Berg zum Geschenk. Da meldete sich ein junger Ritter, er ließ sich von einem tüchtigen Schmied Lanze, Schwert und Schild machen. In das Schild ließ er drei Spiegel setzen. Im Kampf erblickte der Drache sein dreifaches Spiegelbild, stutze, ward derart überwunden und festgespießt. Der Ritter ließ sich die Burg bauen und nannte sich von diesem Tag an „von Spiegel“ und führte drei Spiegel im Wappen. Auch vom Desenberg, der wohl ein Disen-Berg gewesen sein mochte, gibt es die Sage vom bergentrückten Kaiser. „Tief in seinen Innern sitzt er mit seinen Rittern und ruht sich von seinen Siegen aus. Sein langer Bart ist durch den Tisch gewachsen. Oft fragt er die Zwerge, die um ihn versammelt sind, nach der Jahreszahl. Wenn die Zeit gekommen ist, will er mit seinen Heerführern aus dem Berg hinausgehen, um das große Kaiserreich wiederherzustellen. Hirten, die am Desenberg ihr Vieh hüteten, sind oft beim Kaiser gewesen. Mit einer Springwurzel schlossen sie den Berg auf. Manchmal haben sie ihm ihre schönsten Lieder vorgeflötet und sind reichlich beschenkt worden. Ein Bäcker aus Warburg hat einmal dem Kaiser ein Körbchen voll Weißbrot gebracht und erhielt dafür reichen Lohn.“ Der Ort Ossendorfgehört heute zu Warburg, er wurde schon in den „Corveyer Traditionen“ zwischen 825 und 876 als „Pagus Ossenthorp“ erwähnt. Wir werden noch hören, dass die Ortschaftsansilbe „oss-“ auf den Wodankult hinweisen kann. Dass der auffällige Bergkegel eine germ. Kultstätte war, steht außer Frage. Unmittelbar südlich von ihm lag im 1. Jh. n.0 eine Ansiedlung germ. Kunstschmiede die Silber, Bronze, Blei und Eisen verarbeiteten. Ihr Wohnstallhaus, die Korn- und Heuspeicher, die Grubenhäuser der Schmiedewerkstätten, sowie Bronzeschmelz- und Rennöfen, zwecks der Verhüttung von Raseneisenerz, wurden gefunden. Doch in der Gemarkung Daseburg wurden bisher archäologische Funde aus nahezu sämtlichen Epochen der Frühgeschichte ergraben. Auf den hiesigen fruchtbaren Bördeböden ließen sich frühe Bauernsiedler nieder, die wegen der Verzierung ihre Keramik als „Bandkeramiker“ bezeichnet werden. In Daseburg wurde eine ihrer Siedung ausgegraben, mit Häusern von fast 30 m Länge und 7 m Breite. Die ca. 7.000 Jahre alte „Daseburger Kreisgrabenanlage“, wie man diese Kalenderbauten heute wissenschaftlich nennt, ist auf den Desenberg ausgerichtet, der von der Mitte des Grabens gesehen die Untergangsposition der Sonne zur Sommersonnenwende anzeigt.
Um 40 km südlich Warburg, nahe Bad Wildungen, liegt Odershausen. Zwei Flurnamen aus der Feldmark der nahen Stadt Frankenau sind Wodenberg und Wodehain. Noch weiter südlich, Odensachsen, urkundlich 1003 erwähnt, liegt zwischen Bad Hersfeld und Fulda. Im 14./15. Jh. ist ein Adelsgeschlecht „von Otensassen“ in verschiedenen Urkunden des Klosters Fulda erwähnt. Aus einer Urkunde von 1265 ersah Jacob Grimm den Vodinberg. „Die in der Nähe von Gießen, und eine kleine halbe Stunde von Gleiberg gegen Westen gelegene Burgruine heißt in alten Urkunden Vogedesberg, Vodenberg, Voitzberg, Foutsberg, Faitsberg. … In dem Vertrage zwischen Landgraf Heinrich zu Hessen mit Hartrad, Herrn zu Merenberg, vom 29. Sept. 1265, gab ersterer den Berg Vodinberg mit dem dazugehörenden Walde zu Lehen.“ (Fried. K. Abicht, „Der Kreis Wetzlar“ I., 1836, S. 102 ff) Ob ein Vogt, oder Vodo, oder Voden-Wodan der ursprüngliche Namensgeber war, bleibt offen. Der lothringische Vaudémont hieß einst Wadanimontis (Grimm „Dt. Myth.“, 139f). Ein Woendsrecht (Wodani trajectum, also Wodansfurt) liegt unweit von „Bergen op Zoom“ in Holland, ein Woensel (Woedens sele, also „Wodans Saal“) in Nordbrabant. Ein brandenburgisches Wothenow (Wotanaue) und ein thüringisches Wudaneshusun / Woteneshusun (Wotanhausen) erweisen die Chroniken. Beim 876 erstmals urkundlich erwähnten thüringischen Sömmerda liegt Gutmannshausen, das in erster Nennung im „Brevarium sancti Lulli“ des 8. Jhs. als ein Wotanshusen und 876 als Uoteneshus aufgeführt wird. Die Namensänderungen lassen sich besonders gut am Beispiel der Gemeinde Gutenswegen bei Magdeburg verfolgen; es hieß 937 Wuatanesweg, 941 Vodeneswege, 973 Vodensweg, 1231 Wodenswege, 1300 Wodenswegen, 1382 Gudenswegen, 1785 Gutenswegen. Ein weiteres Beispiel aus dem Landkreis Göttingen: 997 Uuosthalmeshusun, 1013 Uuosthalmeshusun, 1022 Wosthelmeshusen, 1022 Wosthelmeshusen, (1118-1137) Guntelmeshusen, 1207 Guntelnnhusen, 1229 Guntilmishusen, 1262 Guntelmeshusen, 1457 Guntillemshusen.
Schauen wir in den niedersächsischen Raum. Die Gemeinde „Groß Oesingen“ war ein urkundlich 1222/1252 erwähnter Herrensitz, der aus archäologischen Grabungen bereits in das 11. Jh. datiert wird. Wenige Kilometer östlich liegt ein „Heiliger Hain“. Der Ort lag an der wichtigen Handelsstraße von Hamburg nach Braunschweig. Weiter Richtung Braunschweig gelangt man zur Sassenburg, auch Balkenbarg oder Balkburg genannt, eine Niederungsburg mit Ringwall an der Aller. Etwas abseits, östlich des Weiterweges, liegt Osloß (Lkr. Gifhorn), das die Namen trug: 1274 Osleue, 1309 Uslussen, 1566 Osselesse. Südlich von Braunschweig liegt Rüningen, welches urkundlich erwähnt wurde, weil 780 der sächsische Fürst Odiltag (Uodiltag) und seine Gattin Wentelsuint mehrere Güter, darunter Riungi, an das Kloster Fulda verschenken. Südlich von Rüningen am Tiedebach wurde eines der größten Urnengräberfelder des vierten bis sechsten Jhs. n.0 entdeckt. Bisher konnten um die 6.000 Gräber - niedergelegt im Zeitraum von 300 Jahren - dokumentiert werden. Hier gedieh ersichtlich die germ. Volkskraft, aus der sich die Allamannenstürme des 3. und 4. Jhs. gegen die röm. Befestigungswerke des Limes speisten. Und die Funde beweisen, dass die röm. Politik unbeirrbar bestrebt war, auch noch in dieser spätröm. Kaiserzeit das freie Germanien zwar nicht mehr zu unterjochen, doch durch Vorstöße bis weit in den Norden hinein, seine Konsolidierung nachhaltig zu stören und bei den nicht vertraglich eingebunden Germanenstämmen das schnöde Geschäft der Sklavenjagd zu betreiben. Im südlich ca. 60 km entfernten Harzraum kam es zu solch einer Abfangschlacht.
Das Odfeld ist eine Hochebene zwischen dem niedersächsischen Ith und dem Solling im Landkreis Holzminden im Weserbergland, wo der Otterbach entspringt, der bei Lüchtringen in die Weser mündet. Das Odfeld liegt im Nordosten des Gemeindegebietes von Negenborn zwischen dem Kloster Amelungsborn und Eschershausen. Negenborn hieß um 908 Nighunburni, was auf die neun Quellen im Ort zurückzuführen ist. Die Neunzahl hatte für unsere noch freigläubigen Vorfahren eine heilige Bedeutung, woraus die kultische Wertung auch dieser Stätte hervorgeht. Alte Bezeichnungen Eschershausens waren 1015 Assiereshusun („Vita Meinwerci“), 1054 Ascgereshuson („Vita Godehardi“), 1062 Aschereshusen (Urkunde Kaisers Heinrich IV.), so dass von einem ursprünglichen Asenhausen auszugehen sein dürfte. Die Stätte offenbart sich demnach als ein Ahnenhausen bzw. als ein altsächsischer Begräbnis- und Andachtsort. Amelungsborn ist die zweitälteste Klostergründung des Zisterzienserordens in Niedersachsen, woraus die altgläubige Bedeutung der Stätte abzuleiten ist. Um 15 km nordwestlich, über die Weser hinweg, liegt die Gemeinde Ottenstein. Die Burg Ottenstein und der Flecken wurden bereits 1182 urkundlich erwähnt. Im Norden und Osten wird das Odfeld vom Vogler und vom Homburgwald überragt, im Süden grenzt es an das Hooptal. Es liegt in einer Höhe von 230 bis 280 m ü. M. und ist überwiegend landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt, Teilbereiche sind auch bewaldet. Die Herkunft des Namens Odfeld ist als vorchristlicher Volksversammlungsplatz bzw. Thingplatz der altsächsischen Od-Religion zu deuten. Die Herleitung von lat. campus odini ‚Odins-Feld‘ ist wahrscheinlich, was einer Herleitung von od ‚Gut / Eigentum‘ nicht widerspricht. Der aus dem westlich liegenden Ort Eschershausen stammende Schriftsteller Wilhelm Raabe hat seinen historischen Roman „Das Odfeld“ danach benannt: Am Nachmittag des 4. Novembers 1761 werden zwei Männer auf dem Odfeld Zeugen einer mächtigen Vogelschlacht, bei der sich Rabenschwärme aus dem Norden und dem Süden bekämpfen, was vom Magister als unheilvorhersagendes Vorzeichen für die bevorstehenden Kriegsgeschehnisse gedeutet wird. Es ist die Zeit des „Siebenjährigen Krieges“ mit seinen Abwehrbemühungen gegen die eindringenden Franzosen und ihren Gräueltaten. In W. Raabes Text, Kap 4, heißt es: „,Dort über dem Odfelde, über dem Quadhagen ! … Sie [die beiden Rabenschwärme] fahren wahrhaftig auf sich los, sie brechen auf einander ein … über dem Odfelde ! Über dem bösen Gehege - dem Campus Odini, dem Wodansfelde ! Man sollte es fast als ein Praesagium nehmen, daß sie sich gerade diese Stätte zur Ausfechtung ihrer Streitigkeiten auserwählt haben. O siehe, siehe, siehe, und immer mehr, immer neuer Zuzug von Mittag wie von Mitternacht.‘ …,Und was soll die Tröstung für uns sein, Magister Buchius ?‘ ,Daß das Heer vom Norden Recht behalte ! Daß Seine Durchlaucht, der Herr Herzog Ferdinand, sich wiederum zur richtigen Stunde dem fremden Greuel, den welschen Landverwüstern entgegenwerfe mit den Seinen.‘ … Seine Aufmerksamkeit war ganz allein auf diese mirakulöse Schlacht der Raben, der Vögel Wodans, über Wodans Felde, über dem Odfelde, gerichtet.“
Aus der dänischen Wodin-Kultstätte „Odins Vi“ auf der Insel Fünen wandelte sich der Namen in dän. „Odense“ und deutsch „Ottensee“. Allein aus dieser Tatsache ist die Vermutung abzuleiten, dass etliche deutsche „Otten“-Ortsnamen vom Wassermarder „Otter“ nicht herrühren, vielmehr - wenn weitere einschlägige Merkmale hinzukommen - aus der altgläubigen Oden-Kultstätte. Die niedersächsische Gemeinde Ottingen ist heute Ortsteil der Stadt Visselhövede am Westrand der Lüneburger Heide. Ottingen wurde mit dem 11.10.937 erstmalig urkundlich erwähnt, König Otto I. schenkte der Magdeburger Kirche den Ort Ottingha. Die Ortsbezeichnungen variierten: Oding, Oddestinge, Ottodinge. Zur Gemeinde gehört die Ortschaft Riepholm (aus Reepholz), die schon 967 erwähnt wurde. In der Riepholmer Umgebung gibt es viele Hügelgräber aus der Bronzezeit, die auf eine sehr frühe Besiedlung der Gegend schließen lassen. Die Ansiedlung gehörte zum Fürstentum Lüneburg und Stift Verden. Um 1244 war ein bedeutender Grundherr das Kloster Walsrode. Die Feldmark Ottingen besteht zum größten Teil aus Geestboden. Er ist durch den Fleiß seiner Bewohner in gutes Ackerland verwandt worden. Im Süden von Ottingen ist der Boden sehr niedrig und sumpfig. Durch diese Niederung, welche von alters her die ,,Ottinger Marsch" genannt wird, fließt die Warnau, jedoch der Oberlauf der Warnau ist der Schneebach. Das Kloster Walsrode ist das älteste der Lüneklöster. Es wurde im Jahre 07.05.986 laut Urkunde von König Otto III. durch den Grafen Walo und seine Frau Odelint gestiftet. Einen Kilometer westlich von Ottingen und nördlich des Weges nach Kettenburg fand man Reste einer urgeschichtlichen Siedlung mit Hausgrundrissen, Feuerstellen, 3.000 Jahre alte Tonscherben sowie das Bruchstück einer Steinaxt. Der bedeutsamste Fund, ein Granitfindling von 1,50 m Höhe und 1,20 m größtem waagerechtem Durchmesser, ist zweifellos von Menschenhand gestaltet worden. Bei der Untersuchung seiner Umgebung zeigte sich, dass hier eine etwa runde Grube mit drei Meter oberem Durchmesser etwa 1,70 m in den Boden eingetieft gewesen ist und dass der Findling am Rande dieser Grube aufgerichtet war. In der Grubenfüllung fanden sich Tonscherben, Holzkohlestücken und Feuersteingeräte. Über den ehemaligen Zweck des Steines können wir nur Mutmaßungen anstellen, doch der kundige Forscher Rudolf Dehnke erklärt den Findling gut begründet als Opferstein unserer Vorfahren in dessen Umgebung kultische Feuer entzündet wurden, von denen sich noch Holzkohleteile rings um ihn her anfanden und die auch in die Grube gerieten. Hier wurde also der Oding-Kultplatz nachweisbar. Unweit östlich von Verden an der Aller liegt der Ort Kirchlinteln, um 9 km nordöstlich davon Odeweg (auch Othwede), das 1144 erstmals unter dem Namen Etthewide in einer Schenkungsurkunde des Bischof Thietmar II. von Verden erwähnt wurde. Er schenkte den Domherren des Verdener Domkapitels einen Hof in Odeweg samt dazugehörigen Abgaben, den Zehnt desselben Ortes, dazu einige Hörige. Die dortigen Siedlungsspuren reichen bis in die Eiszeit zurück. In der Lehringer Mergelgruben wurde der 100.000 Jahre alte, noch in den Rippen eines Waldelefanten steckende älteste Speer der Welt gefunden. An den Hanglagen der Aller, am Gohbach und am Rande des Holtumer Moores sind ca. 630 Hügelgräber aus der Bronzezeit (2.500 -1.400 v.0) nachzuweisen. Odeweg liegt um 15 km von Verden an der Aller entfernt, in der „Hügelgräber-Heide“, nördlich der Stätte liegt das „Weiße Moor“. Neben den bronzezeitlichen Hügelgräbern befinden sich in unmittelbarer Nähe Hohlwegspuren, den Zeugnissen uralter Handelswege. Der Ortsbegriff Odeweg scheint auf die Güterverkehrsstraße von den Niederlanden und Bremen nach Lüneburg (altsächs. Hliuni, langobardisches Wort für „Zufluchtsort“) hinzuweisen, aber die alte Form weist eher auf ein Weideland hin, durch das Wege nach Lüneburg führten. Lüneburg liegt auf einem Salzstock der die Stadt reich machte. Aus unterirdischen Quellen fließt hier eine Sole, die ungewöhnlich hoch konzentriert ist. Ab wann genau das „weiße Gold“ abgebaut und verhandelt wurde ist ungewiss. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Salzabbau 956, als König Otto I. den Zoll der Saline dem Michaeliskloster zusprach. Die langobardischen Urnengräberfelder vom Lüneburger Zeltberg sowie dem ehemaligen Bauerndorf Oedeme stammen aus den ersten Jahrhunderten heutiger Zeitrechnung. Das Rittergeschlecht Odeme, auch Odem genannt, gründet dort seinen Familiensitz.
Der Ort Ebergötzen (Lkr. Göttingen) erhielt seine früheste schriftliche Erwähnung in einer Urkunde Heinrich II. als Euergoteshem mit fingiertem Datum 1013 bzw. 1022. Ein altgläubiges Gottesheim wird es gewesen sein, mit oder ohne Eber. Um etwa 30 km nördlich dehnt sich am Südwestrand des Harzes der Vogelberg, der hier den Namen Harzhorn führt. Nahe dem Dorf Wiershausen (826 / 853 Wuringereshusen) bei Kalefeld versuchten um das Jahr 235 n.0 germ. Kampfverbände einem römischen Heereszug den Weitermarsch zu sperren. Es wurde ein blutiges Gemetzel, bei starkem Einsatz von technologisch überlegenen röm. Schleudermaschinen, deren Hinterlassenschaften in nicht geringer Anzahl gefunden wurden. Der damals regierende Soldatenkaiser Maximinus Thrax empfing für seine Terrorzüge und dem angeblichen Sieg in der großen Schlacht im Moor („proelium in palude“) den Ehrentitel „Germanicus Maximus“ (Größter Germanenbesieger). Etwa 6 km westlich des Schachtfeldes liegt der Ort Opperhausen, hier könnten die während der Schlacht gefangen genommenen Römer dem Kriegsgott geopfert worden sein. Um 3 km nördlich von diesem Platz liegen im engen Tal die Dörfer Kreiensen und Greene, nur durch den Fluss Leine getrennt. Durch dieses einstmals sumpfige Gelände muss sich der röm. Schreckenszug durchgewunden und auf beiden Seiten Not und Weinen verursacht haben. Die Namen der Dörfer könnten davon bis heute künden, denn ahd. grīnan = jämmerlich weinen / schimpfen / wimmern wäre als Ursprungsbezeichnung der Stätte durchaus denkbar. Die drei letztgenannten Ortsteile gehören zur Stadt Einbeck, vor dessen südlicher Haustüre Odagsen liegt.
Es wird nicht nachvollziehbar gern behauptet, Odra sei ein slawischer Name von Städten und Flüssen, wie beispielsweise jenem des ostdeutschen Flusses Oder. Doch eine Oder fließt durch „Hattorf am Harz“ und im ebenso kerngermanischen Thüringen kommt der Begriff ebenso vor. Die erste urkundliche Erwähnung der Ansiedlung Uder (Lkr. Eichsfeld) erfolgte 1089 als Udra, 1137 und 1158 als Othera, 1162 als Udera, 1205 als Odra oder Odera, 1241 wieder als Udera und 1588 als Ohder. Die Lautverschiebungen von „o“ zu „u“ und umgekehrt sind möglich. Im Leine-Tal führte die alte Heeresstraße hier vorbei. Nahe bei gibt es den Flurnamen „Alte Burg“ am Fuße des Bergrückens einer „Elisabethhöhe“, auf der, den Mauerfunden folgend, eine einstig Befestigungsanlage angenommen wird. Die „Elisabethhöhe“ erinnert an die Missionierung des Eichsfeldes durch den rührigen Bonifaz(ius) und veranlasst zur Vermutung, dass die „Elisabethhöhe“ vormals einem altgläubigen weibliche Heilswesen geweiht war. Das erstaunt nur Menschen, die völlig unreflektiert davon ausgehen, vor der christlichen Verkündigung hätte so eine Art Nullzeit geherrscht. Wir können uns aber die religiösen Gegebenheiten in den alten Kelten- und Germanenlanden gar nicht lebendig genug vorstellen. Über die Jahrtausende gewachsene und verfeinerte Glaubensgewissheiten führten zu ausgereiften rituellen Formen und Brauchtümern, die erst durch die römischen Terrorzüge verunsichert, durch die Völkerwanderungsturbulenzen gestört und schließlich durch die Romkirche zerschlagen und zum Teil in den tarnenden Untergrund gezwungen wurden. Der Ortsname Heiligenstadt im Obereichsfeld weist auf eine altgläubige Heilige Stätte hin, die erstmals mit dem um 960 errichteten „St. Martinsstift“ in Verbindung gebracht wurde. Ein Merowingerkönig Dagobert soll hier Heilung von seiner Hautkrankheit gefunden haben, zudem sei ihm im Traum offenbart worden, dass an jener Stelle die Märtyrer „hl. Aureus“ und „hl. Justinus“ begraben lägen. Da aber Dagobert nachgewiesenermaßen niemals ins Eichsfeld gekommen ist, wird auch diese Erzählung als eines der vielen frei erfundenen Kirchenlegendchen demaskiert. Nach örtlicher Tradition war der ursprüngliche Name: „Zuenchen“ bzw. „zum Hænchen“ (zum hl. Hain). Der Bevölkerung war ihre Kultstätte ganz offensichtlich so lieb und wert, dass sie davon nicht lassen mochte und demzufolge sich die Kirche gedrängt sah, als Gegengewicht den Ort mit ihren eigenen „heiligen“ Produkten voll zu füllen. Man gab vor, hier Märtyrer-Gräber des „hl. Sergius und „hl. Baccus“ gefunden zu haben, schließlich brachte man noch Reliquien der „hl. Aureus“ und „hl. Justinus“ hinzu. Um 973 scheint die Umbenennung in „Stätte der Heiligen“ / „Heiligenstadt“ erfolgt zu sein. Dann um 1100 ist „St. Martin“ ein Archediakonat mit 8 Pfarreien, zu denen bald noch 7 Klöster hinzukamen. Heiligenstadt wird in dieser Zeit zum bedeutendsten kirchlichen Zentrum Nordthüringens aufgebaut.
Gotha in Thüringen ist als „Villa Gotaha“ in einer fränkischen Urkunde von 775 erwähnt -; ich komme darauf zurück. Göttingen in Niedersachsen verbürgt sich erstmalig urkundlich 953 als Gutingi. Zwei weitere kleine Göttingen befinden sich nördlich Marburg sowie nordöstlich Ulm. Die kleine westfälische Burgsiedlung Oeding liegt bei Südlohn. Nahe Mönchengladbach gibt es Ueddingen, früher: Uddinc / Dudonck / Dudunck / Dudyngh -, was aus einem heidnischen Urbeginn als Oding hervorgegangen sein wird. Es ist die älteste Neuwerker Honschaft. Ein Auenhausen, auch als Adonhus belegt (Ortsteil von Brakel südwestl. Höxter), wurde zwar von Bischof Bernhard (1127-1160) dem Kloster Abdinghof in Paderborn geschenkt (Urkunde-Nr. 33-1147), doch der Haupthof des Ortes war in Besitz eines Johann von Odenhusen und bis 1273 dem Kloster Gehrden abgabepflichtig. So dürfte Auenhausen nur ein früh umgetauftes altheiliges Odenhusen sein, welches unter unverfänglicherem Namen jenen gierigen Klosterbrüdern überantwortet wurde, die schon im Jahre 1093 die heidnische Kultstätte des Externstein-Bezirks im Teutoburger Wald aufgekauft hatten. Ein Odenberg findet sich südwestlich von Godenau und westlich von Alfeld (an der Leine). Ein Othfresen ist bei Goslar und ein Odagsen südlich von Einbeck. Im nahen Moringen-Großenrode hat man eine der hier mehrfach gefundenen, rund 5.000 Jahre alten sog. Totenhütten originalgetreu nachgebaut. Odagsen wurde 1241 erstmals urkundlich erwähnt, es entwickelte sich aus einem Hof Osdageshusen über Osdagessen. Der legendäre Gründer soll ein Osdag, Sohn des Amelung gewesen sein, doch das ändert nichts, denn Os- ist nur die niederdt. Form für Ase bzw. Gott, also kommt ebenfalls ein Jünger des Wodan in Betracht. Der Name von Asemissen, einem Ortsteil von Leopoldshöhe (Kreis Lippe), kommt als Orts-, Hof- und Familienname vor. Asslar ist eine Stadt nahe Wetzlar. Die Endsilbe „-lar“ (altfränk. „-hlar“ / „-hlari“) bedeutet Weide / Wald (vgl. Goslar, Fritzlar, Dorlar). Zuweilen wird sie als keltischer Begriff für Hürde / Gerüst / Gestell einer zaunähnlichen Befestigung des Hofes oder Dorfes gedeutet. Nicht weit davon lag die Wüstung Wanendorf, südwestlich von Wetzlar-Dalheim. Kelt. und germ. Siedlungen sind nachgewiesen, doch ob die genannten Dörfer mit den beiden germ. Göttergeschlechtern der Asen und Wanen in Zusammenhang stehen könnten, bleibt fraglich. Hier, in einer ehemaligen Schleife der Lahn, gab es schon „bandkeramische“ Siedlungen, die Teil einer systematischen Besiedlung des Lahntals darstellen. Ein Dutzend durch Wall und Graben gesicherte, vor mehr als 7.000 Jahren errichtete Pfostenhäuser, waren je 30 m lang. Die Eisenverhüttung und -verarbeitung hat im Bezirk eine rund 2.500-jährige Tradition. Der Ort Asbach / Aspach (Landkr. Neuwied) wurde nach 1180 erstmals urkundlich erwähnt. Es ist in der Zeit der fränkischen Landnahme zwischen 600 und 900 entstanden, was auf einen heidnischen Asen-Verehrter hinweisen dürfte. Ein anderes Asbach (Landkr. Birkenfeld) liegt am Hinterbach im Übergangsbereich der Kempfelder Hochmulde zur Idar-Soon-Pforte östlich des Idarwaldes. Ein Kloster Asbach findet sich im Ortsteil Asbach des Marktes Rotthalmünster inmitten des sog. „Klosterwinkels“ am Pilgerweg „Via Nova“ in Bayern. Ein Asbach ist Ortsteil der Gemeinde Obrigheim der Burgenstraße an den Ausläufern des Odenwaldes am Westufer des Neckars. Ein Ostinghasen (Ostinchusen / Osedinghuse) existiert südwestlich Lippstadt, etwas nördlich dort ein Wadersloh, was wohl als Wodanforst zu deuten wäre. Wie ungezähmt die Menschen in dieser armen Gegend waren, ersieht man daran, dass die gesamte beiliegende Bauernschaft Ostholte i.J. 1299 aus der Kirche ausgeschlossen (exkommuniziert) wurde, wegen „vorenthaltenen Zehnten als auch für ihre Halsstarrigkeit....“ Ein Urhof Godesloh (Wodanwald / Gottesforst) wird 1153 bei Paderborn genannt. Ein Oetinghausen liegt bei Herford. Westlich Hannover gibt es Wunsdorf, das noch 1179 die Bezeichnung Wodenstorp trug.
In diesem altsächsisch-fränkischen Grenzraum mehren sich nach Norden zu die Ortschaften mit Os-, Oss- und Ös-Anlautungen. Der Teutoburger Wald, oder ein Teil davon, hieß bis ins 18. Jh. Osning. Ein Osdorf liegt vor Hamburg. Bei Oldenburg gibt es den Osenberg. Er ist der aus den Gottessilben „âs-“, „ans-“, „os“- gebildete Begriff für den heiligen Berg oder Wald. Ebenso ging erkennbar der Name Osnabrücks daraushervor: lat. Ansibarium, 8. Jh. Osnabrucg(ensis), 9. Jh. Osnaburgensis, Osnabrukgensi, 1003 Asenbrungensis, 1005 Asanbrunensis, 1025 Asnabrug(g)ensi) aus Asebruggi („Brücke der Asen“ / „Götterbrücke“). Nordöstlich von Osnabrück liegt Astrup (1090 Asthorpa) bei Belm. Um 20 km nördlich des Harzer Brockens liegt Osterwieck am Südhang des „Großen Fallsteins“. Der Ort wurde Ostrewic, dann 1073 „gemeiniglich Asterwiek“ bezeichnet, in einem Brief des Erzbischofs von Bremen an die Bischöfe von Halberstadt, wegen deren Rechtshändel. Aschendorf an der Ems ist einer der ältesten Orte in Niedersachsen. Um 800 erfolgte die Gründung einer Taufkirche, was grundsätzlich auf einen besonderen Ort des Altheidentums hinweist, von dem aus intensive Mission betrieben werden sollte. Die früheste Bezeichnung war Ascanthorp (später Asikinthorpe), wie aus der „Vita Liudgeri“ zu erfahren ist. Bis zum 13. Jh. errichtete man die erstaunliche Menge von 5 Kirchen, woraus die Intensität der verbissenen Missionsbemühungen in dem Raum unschwer abzulesen ist. Kirchenrechtlich gehörte Aschendorf immer zum Bistum Osnabrück. Die Stadt Aschersleben (753 Ascegereslebe) im Salzlandkreis ist die älteste urkundlich erwähnte Ansiedlung in Sachsen-Anhalt; sie wird als „Tor zum Harz“ bezeichnet. Das uradelige Geschlecht der Askanier leitet seinen Namen von Ascharia, dem latinisierten Namen ihres Burgbesitzes ab. Wie im Mittelalter unter christlicher Regie allgemein üblich, deutete man albernerweise die Namen nach griechisch-römischen oder biblischen Mythengestalten. In diesem Falle von Askanius, dem Sohn des trojanischen Helden Aeneas bzw. von einem Aschkenas, dem Urenkel des Archenbesitzers Noah. Dass der Begriff auf Anhänger des urdeutschen wodanischen Asen-Glaubens zurückgeht, darf bis heute kaum angedacht werden. Die kuriosesten Deutungen aus mediterranen oder orientalischen Ableitungen gelten bis in unsere Zeit hinein als unverfänglicher.
„Karl der Große“ soll im Tilithigau um 780 Ohsen (das spätere Kirchohsen der heutigen Gemeinde Emmerthal) als Missionszentrum mit Kirche gegründet haben, das von etwa 800 bis 1200 Archidiakonat des Bischofs von Minden war. Im Jahre 1004 fand erste urkundliche Erwähnung Ohsens statt. König Heinrich II., „der Heilige“, unterzeichnete eine Urkunde in der „Villa Ohsen“. „Ohne auf weitere Überlegungen zur Deutung des Namens einzugehen, sei nur darauf verwiesen, dass sich hinter ,o-' germ. ,au-' verbergen wird und somit Parallelnamen in Oesede bei Osnabrück, 826-876 in Osidi, und Osede, Oese (Wüstung bei Elze), 1022 Asithe, also in zwei -ithi-Bildungen, vorliegen dürften. Ohsen gehört somit in eine Namengebungsperiode, die weit vor die fränkische Eroberungsepoche zu datieren ist“, schreibt Prof. Dr. Jürgen Udolph („Fränkische Ortsnamen in Niedersachsen“, 1998). Daraus ergibt sich die Einsicht, dass auch hier wieder einem altgläubigen Asen-Ort ein christliches Missionszentrum aufgepfropft wurde, wenn davon ausgegangen werden darf, dass der Ortsname aus altnord. „ass“ = Gott / Ase, altnord. „askyndr“ = asenstämmig / gehörend zum Geschlecht von Asen, und nicht aus altnord. „askr“ = Esche / Spieß entstanden ist. In Astheim, einem Ortsteil der Gemeinde Trebur (Krs. Groß-Gerau / Hessen), wurden alamannische und fränkische Gräber gefunden, auch ein röm. Militärlager. Die urkundlichen Erwähnungen als Besitz des Klosters Lorsch nennen es: 830 - 850 Askemuntesheim, 1099 Astehem, 1331 Astheym, 1579 Astumb, 1647 Astum. Unter Berücksichtigung von ahd. mundæn = schützen (ahd. mundilingus = Beschützer, Hüter, ahd. mundwaldus = Vormund) könnte die Urbedeutung des Ortsnamens „Asenschutzheim“ gewesen sein. Eine Gemeinde Osterby existiert westlich von Windeby und ist keineswegs das östlichste Dorf am Ende der Eckernförder Bucht. Ein Osterby (dän. Østerby) liegt etwa 16 km westlich von Flensburg. Ein drittes Osterby auf der Halbinsel Kegnæs, am Ausgang der Flensburger Förde, ist eine Bezeichnung des 17. Jhs. und tatsächlich nach der Himmelsrichtung benannt. Der Name des niedersächsischen Esbeck (Lkr. Helmstedt) bei Schöningen beruht auf dem ahd. Wort Asbike und bezeichnet die Ass-Ansiedlung an einen Bach (mndt.: Bäke, Beek, Beeke), der im angrenzenden Elm entspringt und von dort in den Ort fließt. Erstnennung erfolgte 1137 als Aesebiki. Die dortige „Burg Esbeck“ gehörte einem braunschweigischen Uradelsgeschlecht, das Mitbesitzer der Asseburg war. Südöstlich von Hannover, am südwestlichen Ortsrand von Wassel, finden sich die Reste des Ringwalles „Asseburg“ von ca. 70 m Durchmesser, der auf Karten des Jahres 1781 noch vollständig erhaltenden war. Eine weitere Asseburg ist die Höhenburg auf einem schmalen Bergkamm des Höhenzuges Asse unweit Wolfenbüttel. Esbeck (1012 Aspike) ist ein südwestlicher Ortsteil der Stadt Elze im Süden von Hannover. Esebeck heißt auch der nordwestlichste Stadtbezirk Göttingens. In der „Vita Meinwerci“ ist 1036 ein Ort namens Asbiki urkundlich erwähnt. Unklar ist, ob es sich dabei um dieses oder um Esbeck bei Lippstadt handelt.
Den Heilsbegriff, den wir andernorts in unbekannt gewordenen Wortformen suchen müssen, trägt die Hochseeinsel Helgoland ganz erkennbar offen. Er ist gebildet vom niederdeutschen Ausdruck für „Heiliges Land“. Mehrere Hügelgräber auf dem Oberland und der Fund steinzeitlicher Werkzeuge, lassen die frühe Besiedlung erkennen. In der „Naturgeschichte von Plinius des Älteren“ wird der Reisebericht des „Pytheas aus Massilia“ von 325 v.0 besprochen, in dem dargelegt wird, dass an die Strände der Insel Abalus der Bernstein im Frühling von den Wellen angeschwemmt wird. Die Anwohner gebrauchten ihn statt Holz zum Feuern und verkauften ihn an die benachbarten Teutonen. Und dass es Timaeus bestätigt hätte, die Insel aber Basileia genannt. Unter Basileia verstand man so etwas wie Königsinsel, im höchsten Sinne aber eine Insel der „Herrschaft Gottes“. Der Begriff Abalus wäre aus indogerm. aballo = Apfel zu verstehen. Aus der kelt. Mythologie ist Avalon / Avalunals sagenhafte, mystische Jenseitswelt einer Apfelinsel oder eines Apelgartens bekannt. Aus nordischen Legenden ist Idun (altnord. Iðunn = Erneuernde / Verjüngende), Göttin der Unsterblichkeit, jene Symbolgestalt der Hüterin „goldener Äpfel“, welche den Göttern ihre ewige Jugend schenken. Claus von Carnap-Bornheim, Direktor des „Archäologischen Landesmuseums in Schleswig“, erklärt: „Die nautischen Fähigkeiten der stein- und frühbronzezeitlichen Seeleute sind zweifellos größer gewesen, als wir es zunächst vermuten möchten. Schon vor gut 5.000 Jahren haben sich offenbar Menschen auf die unsichere und gefährliche Seereise nach Helgoland begeben.“ In Schwesing bei Husum entdecken Archäologen in einem 5.000 Jahre alten Großsteingrab einen 43 Gramm schweren Goldreif aus Irland. Die waghalsige nordische Schifffahrt - ein Steinzeitwikingertum - erreiche damals schon die westlichen Grenzen Europas. Nebenbei bemerkt: Aus dem Hafenbecken von Husum hob man beim Ausbaggern ein bearbeitetes Stück Rentiergeweih vom Spantengerüst eines Fellbootes das als Teil des bisher ältesten gefundenen Wasserfahrzeuges angesehen wird. Es stammt von eiszeitlichen Küstenjägern vor 10.500 Jahren der „Ahrensburger-“ bzw. „Hamburger Kultur“, welche in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz existierte. Die Helgoländer waren im Besitz kostbarer Waren, die sie verhandeln konnten. Hier findet sich neben dem angeschwemmten Bernstein ein mythischer Stein, der überall an der Nordseeküste gefragt war: Roter Helgoländer Flint, rotbraun, lachs- bis burgunderfarben, weißgraue und gelbe Einsprengsel, dunkles Außenband mit oft weißer Kalkhaut. Noch heute legen Starkwindlagen auf der Düne größere Knollen frei. Auf den begehrten Rohstoff für Beile, Meißel, Dolche und Sicheln gründete sich der erste Überseehandel des Nordens. Rot ist die Farbe des Lebens. Der Inselexport war konkurrenzlos, vergleichbare Farbspiele sind von anderen Vorkommen nicht bekannt, dem frühgeschichtlichen Menschen bot Helgoländer Flint einen überwältigenden optischen Eindruck. Von der nachhaltigen, rauen Eigenbestimmtheit legten die Helgoländer noch im Mittelalter ein eindrucksvolles Bekenntnis ab. Der König Radbod (Herrschaftsdauer 679-719) des Großfriesischen Reiches hat sich den christenkirchlichen Überredungskünsten und Übertölpelungsversuchen, auch dem politischen und militärischen Druck des Frankenreiches, erfolgreich widersetzen können. Es sollen mehrere Burgen, Dörfer und Höfe auf der damals bedeutend größeren Insel gestanden haben. Aus ihrer heiligen Quelle durfte nur schweigend Wasser geschöpft werden. „Bischof Willibrord von Utrecht“ versuchte vergeblich den Glauben an die friesische Gottheit Fosite zu überwinden, wie der Angelsachse Alkuin über „Heiligland“ um 800 berichtet. Die Verchristlichung gelang erst 780 durch Bischof „Liudger von Münster“, der die Heiligtümer des Fosites zerstören ließ und den ansässigen Häuptlingssohn Landicius korrumpierte, indem er ihm Pfründe verschaffte, durch seine unbegründbar gespendete Priesterweihung. Schließlich wurden die Einwohner zwangsgetauft und auf die alten Tempelplätze Kirchen gebaut. „Adam von Bremen“ rühmte 1076 die große Fruchtbarkeit, das gute Weideland und die Verehrung der Insel seitens der Seefahrer und Fischer. Er gab die Kunde vom „Heiligland“ in seinem Tatenbericht „Res gestae“ und in den Scholien dazu wird der frühere Name als Fosetisland, der neue aber als Farria (Rinderland) angegeben. Forseti (altnord. Vorsitzender), galt alsGottheit des Rechtes und des Gesetzes. Er ist Teil des aus der isländisch-norwegischen „Edda“ überlieferten wodanischen Asen-Glaubens.
Asendorf (Krs. Diepholz in Niedersachsen) wird erstmalig 1091 erwähnt, um 1250 gab es eine Pfarrkirche („parochia in Asenthorpe“), auch ein Kloster, welche zum „St. Paul-Kloster“ in Bremen gehörten. Ein weiteres Asendorf liegt am Nordrand der Lüneburger Heide. Hier lebte zum Beginn des 19. Jhs. der „starke Hinnerk“, vom dem schier unglaubliche Kraftstückchen erzählt werden. Ein Asendorf gehört heute zur Gemeinde Kalletal. Assinghausen ist ein Ortsteil der Stadt Olsberg im Hochsauerlandkreis. Der Ort soll um 800 von einem Siedler namens Azzo gegründet worden sein. Astfeld liegt westlich von Goslar. Der Saalekreisort Asendorf ist Teil der Gemeinde Teutschenthal westlich vor Halle in Sachsen-Anhalt. Um 5 km nördlich, am Süßer See, liegt Aseleben. Gut 20 km Luftlinie südwestlich davon zieht sich der Mittelberg (252 m) bei Wangen über der Unstrut hin, als Teil der Gemeinde Nebra im Burgenlandkreis. Wir befinden uns hier am östlichen Rande des „Thüringer Beckens“ tatsächlich in der geographischen Mitte Germaniens. Auf der Hügelspitze des „Mittelberges“ lag die Himmels- bzw. „Kalenderscheibe von Nebra“, jene wunderbare älteste, konkrete astronomische Sternenabbildung der Welt. Der Astronom Prof. Wolfhard Schlosser erklärte: „Zusammen mit der Scheibe war die Wallanlage das älteste Observatorium der Menschheit.“ Auf der zwei Kilogramm schweren, fast kreisrunden Scheibe, mit einem Durchmesser von 32 Zentimetern, befinden sich Goldauflagen, die als Schiff, dazu Mond, Sonne und Sterne gedeutet werden. Eine Ansammlung von sieben Goldpunkten wird als Sternenhaufen der Plejaden in einer Konstellation wie vor 3.600 Jahren erkannt. Der von Holzpalisaden umzäunte Ort, mit einem Durchmesser von 200 bis 350 Metern, war von einem komplizierten Grabensystem umgeben und wurde möglicherweise über 1.000 Jahre genutzt. Etwas Vergleichbares, so der Wissenschaftler, gab es damals nur im griechischen Mykene und Anatolien. Zusammen mit der Scheibe wurden zwei Schwerter, zwei Randleistenbeile, ein Meißel sowie mehrere Armringe aus Bronze gefunden. Bislang konnten über 100 Fundstücke gesichert werden, darunter einen etwa 2.700 Jahre alten goldenen Wendelring, der als Halsschmuck diente. Gleiche Wendelringe wurden auch in Skandinavien gefunden, was u.a. darauf hinweist, dass es damals einen einheitlichen Kulturraum des bronzezeitlichen Nordens gab -, von Nebra bis nach Uppsala. Die hiesige Region des „Ziegelrodaer Forstes“ gehört zu den dichtesten archäologischen Stätten in Europa. In dem Gebiet liegt auch ein urgeschichtlicher Bestattungsplatz mit rund 1.000 Hügelgräbern. Dieser ganze Bezirk war in der Bronzezeit dichter besiedelt als in unseren Tagen. In ca. 20 km Entfernung liegt Goseck, das im 9. Jh. des Hersfelder Zehntverzeichnis als „Gozacha civitas“ erwähnt wird. Die dortige Feste war Stammburg der Grafen von Goseck. Graf Dedi gilt als Stammvater der Wettiner. Das Wort Goseck lässt sich etymologisch erklären aus den beiden begrifflichen Bestandteilen „goz/gos“ und „acha/eck“, welche zusammengezogen als Gotteseck oder besser Gottesacker zu deuten sind. Das ist eine weitere erhebende Überraschung, ein heiliger Bezirk, ein „Gottesacker“, der als solcher bereits in der Steinzeit genutzt wurde, scheint bis in unsere moderne Zeit hinein seinen alten ehrwürdigen Namen zu tragen. Die Tore in den Palisadenringen von Goseck markieren exakt die Aufgangs- und Untergangspunkte zur damaligen Wintersonnwende am 21. Dezember. Eine Toröffnung wies zum generellen Ausrichtungspunkt nach Norden. Unsere urdeutschen „stichbandkeramischen Vorfahren“ begingen also das Weihnachtfest mit religiösen Gemeinschaftsfeiern bereits vor über 7.000 Jahren. Am westlichen Ende des Thüringer Beckens, südlich von Mühlhausen, in der Gemarkung von Niederdorla ist die Stätte eines germ. Opfermoores zu besichtigen. Die Kultstätte wurde im 6. Jh.v.0 (Hallstattzeit) gegründet. Aus dieser Zeit stammt ein rechteckiger Feueraltar aus Muschelkalkstein, der auf einer Seite von einem Stein-Erde-Wall umgeben war. Über die frühgeschichtliche Besiedlung der „Vogtei Dorla“ und das Opfermoor gibt die museale Schau anschauliche Auskunft. Die aufgefundenen Gräber und Siedlungsfunde weisen auf eine Besiedlung seit der Jungsteinzeit um 5.500 v.0 hin. Die Gräber nördlich des Roten Grabens, beim Windberg, bringen den Nachweis der ersten bäuerlichen Kultur, der Linien- und Stichbandkeramiker. Weitere Grabfunde der Rössnerkultur 4.600-4.200 v.0 und der Wartbergkultur um 3.000 v.0 finden sich am Töpfersberg von Oberdorla und durch Funde aus der Frühbronzezeit auf dem Sportplatz von Oberdorla. Sie lassen auf eine durchgehende Besiedelung der Region schließen bis in die germanisch-deutsche Zeit hinein.
Grob beschrieben, liegt Odelzhausen zwischen Augsburg und München. Die erste Nennung des Ortes, als „Otolteshusir“ (Lkr. Dachau), erfolgte in einer Urkunde vom 02.10.814 in den Traditionen des Hochstifts Freising bei München, was heißen will, dass diese Stätte eines Otolt/Odholt an das Geistliche bzw. kirchliche Fürstentum Freising als Schenkung oder Kauferwerb gelangte, wie es bei altgläubig-heidnischen Orten üblich war. Sicher handelt es sich bei der Ortschaft um einen vorchristlichen Kultort der Geistgottheit Od-Wodin-Odin, in enger Verbindung mit einer weiblichen Gottheit, wie der Frija. Odelzhausen hatte ein Schlossgut, das als Burg bereits 1247 erbaut worden war. Aus o.a. Urkunde geht hervor, dass einige Kirchenleute klagten und Anspruch erhoben auf Herausgabe des Ortes, weil ihn angeblich ein „Priester Freido [wahrscheinlich der heidnische Vorbesitzer], zum Heil seiner Seele, dem Hause der heiligen Maria [die Stätte] übergeben“ habe. Die Klage wurde zum genannten Zeitpunkt zunächst abgewiesen. Dies ist geschehen, so der Urkundenwortlaut, „unter der glorreichen Herrschaft des Kaisers Ludwig des Ersten in der 7. Indiktion und im 13. Mond“. Etwas nördlich, hier in der Gemarkung, entstand das Kloster Daxa/Taxa, mit einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte in „Altbaiern“ (1654-1802). Veranlassung war der Fund eines Hühnereies mit dem Relief eines Strahlenkranzes, aus dem man 1719 ein „Gnadenbild“ der fünfstrahligen Sternenmutter malen ließ. Das Bild kam in die Pfarrkirche von Odelzhausen und 1848 wurde auf dem Gebiet des ehemaligen Klosters die „Kapelle Maria Stern“ errichtet. Der alte frauenkultische Aspekt der Örtlichkeit schimmert möglicherweise auch noch hervor aus der Legende von der „Weißen Frau“, dem Schlossgespenst das in zweierlei Gestalt unterwegs sein soll. Als weiße Frau überbringt sie die guten Nachrichten z.B. von einer bevorstehenden Geburt im Schloss, als schwarze Frau dagegen kündigt sie einen zu erwartenden Todesfall an. Wer heute vor den Resten des Schlosses in Odelzhausen steht, einem imposanten Turm und daneben die Ruinen ehemaliger Nebengebäude, der kann sich gut vorstellen, dass es hier spukt.
Im bayrischen Donaugebiet, zwischen Isar und Vils, liegen südlich der Isarmündung mehrere dieser Kalenderbauten. Jener von Meisternthal am Aschelbach war mit seiner genauen ca. 50 Meter langen Ellipse der perfekteste, der meisterlichste. Von den beiden Brennpunkten aus wurden über die Öffnungen im Osten und Westen die Auf- und Untergangspunkte der Winter- und Sommersonnenwende angepeilte. Die Linie Osttor-Westor führte zu den Auf- und Untergangspunkten der Tag- und Nachtgleichen. Um die optimalen Termine für Aussaat und Ernte nicht zu verpassen und um religiöse Rituale zum richtigen Zeitpunkt zu feiern, waren diese Monumentalbauten unumgänglich. Meisternthal wurde von dem Luftbildarchäologen Otto Braasch entdeckt und fotografiert. Die Geophysiker vom Bayr. Landesamt für Denkmalspflege erstellten einen vollständigen Magnetometerplan der Siedlungsfläche mit den Palisaden und dem Ellipsengraben. Es handelt sich um eine jungsteinzeitliche, „stichbandkeramische“ Siedlung, ca. 4.800 v.0, welche 4 bis 5 Generationen lang unterhalten und dann noch einmal ca. 3.800 v.0. von der „Münchshöfener Kultur“ teilweise wiedererrichtet wurde. Allein im mittleren und nördlichen Europa, mit den krassen Klimaschwankungen, den einschneidenden Jahresumschwüngen, den langen Wintern - die zur Vorsorgepflicht zwangen - wurden von einer bäuerlichen Bevölkerung diese Kalenderbauten erdacht und errichtet - ungefähr 2.500 Jahre bevor man in Ägypten mit dem Pyramidenbau begann. Unmittelbar bei Meisternthal, der steinzeitlichen Himmelsbeobachtungsstation, liegt ein Gemarkungsstück von ca. 20 Hektar mit dem Flurnamen „Himmelreich“. Die kleine Kirche aus Ende 13. Jh. ist dem „St. Nikolaus“ geweiht, bekanntlich auch einem kirchenchristlichem Wodan-Ersatzspieler. Nikar oder Hnikar (Edda, „Gylfaginning“, 20) waren Kultnamen des Wodan-Odin. Keine 2 km nordöstlich davon lässt sich die Burgruine von Ettling (Lkr. Eichstätt) finden, auch Oettling genannt. Als erster Vertreter des Geschlechtes erscheint ein „nobilis homo nomine Reginolt de Ottlingin“. 1145 wird das 1190 ausgestorbene edelfreie Geschlecht der Oetlinger (auch „de Otelingen“) erwähnt. 1405 ist ein Jorg Ettlinger als Besitzer der Burg bezeugt. Sie ist der Ruinenrest einer Wasserburg auf künstlicher Insel im Quellteich des Kelsbaches. Heimatforscher meinen, hier müssten die heute noch vorhandenen schönen Quellen bzw. „schönen Brunnen“ sein, bei denen Herr Hagen des „Nibelungenliedes“ die Wassernixen traf, um sie auszufragen nach dem Geschick des Burgunderzuges ins ungarische Hunnenland. Er hatte ihnen ihre Gewänder geraubt, um sie zu zwingen, den Nibelungen die Zukunft zu künden und einen Fährmann zum Übersetzen über die Donau zu verraten. Nördlich von Ettling, jenseits der Isar, liegt das Dorf Otzing (Lkr. Deggendorf), wo archäologische Funde, wie ein mehr als 7.000 Jahre altes Skelett in einem Hockergrab, Hügelgräber und der Keltenhain von der uralten Entwicklungsgeschichte der Gemeinde berichten. In der Gemarkung Otzing gibt es den Asenhof. Südöstlich von Augsburg liegt die Ortschaft Odelzhausen. Erste Nennung des Ortes als „Otolteshusir“ 814 n.0. Der Name kam angeblich von einem Sippenältesten namens Otolt/Odholt, wohl eher aber vom germ. Geistgott Wodin/Odin (Odolt = der alte Od). Odelzhausen ist ein Schlossgut, das 1247 als Burg errichtet wurde. Das nahe Kloster Taxa war 1665 einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte in „Altbaiern“.
Doch nach diesem Abstecher in den Donauraum, wegen der „Kalender-Kreisgrabenanlagen“, zurück im den Nordwesten von Nordrhein-Westfalen. Im Münsterland liegt Dorsten, wo die germanischen Sugamber siedelten, bevor die Brukterer und schließlich die Sachsen vom Norden herandrängten. Ihre bäuerlichen Siedlungen sind im ganzen Stadtgebiet entlang der Lippe nachweisbar. Der röm. Feldherr Lollius versuchte im Jahre 18 v.0 hier einzudringen, musste aber eine schwere Niederlage mit dem Verlust eines Legionsadlers hinnehmen. Die späteren Eingriffe der Römer in diesem Gebiet waren brutal und nachhaltig, es wurden Militärlager errichtet und die Deportation von ca. 40.000 Sugambrern nach Westen erzwungen. Unter dem militärischen Schutz der katholischen Hausmeier des Frankenreiches („Pippin der Mittlere“ 680-714) begannen hier die ersten Fremdlinge aus England, z.B. Suitbert, für den Christengauben zu werben. Unter Karl, dem Frankenkönig, ist dann der Christianismus dem Volk mit Gewalt eingebläut worden. Und welches grauenerregende Unsinnsgewürge den Menschen mit der Christianisierung ins Gehirn gezwungen wurde, von okkulter Weltflucht, Wundergläubigkeit, zauberischem Mummenschanz der „Kommunion“, der „Sakramente“, des „Reliquienkultes“, der Jenseitsbesessenheit, des Naturhasses, Selbsthasses, der Sünde und Todsünde, der Buße und des Leidwillens, Mitleidens, der Frauenverachtung und Frauenentrechtung -, das vermag nur der ganz zu ermessen der den nötigen kritischen Abstand von diesen Verstrickungen menschlichen Wahnes gefunden hat. Nach der würdevoll hohen Auffassung vom Wert des Weibes im germanischen Denken, bis hin zum Fall in den Unsinn solcher Überlegungen, ob die Frau als ein Mensch, oder eher doch als Tier, oder als Zwischenwesen zwischen Mann und Tier zu verstehen sei, kann man sich die Verwirrungen und Erschütterungen ganzer umerzogener, belehrter, belauerter und bedrohter Generationen durch psychotische christliche Fanatiker gar nicht dramatisch genug vergegenwärtigen.
Etwas nördlich von Dorsten liegt das Dorf Heiden, das um 870 in einer Schenkung an das sehr aktive Missions-Kloster Werden erstmals urkundliche Erwähnung fand. In dessen Klosterschreibstube ist die epische Meisterleistung der altsächsischen Dichtung „Der Heliand“ als zutiefst unehrliche christliche Werbeschrift verfasst worden. Etwa 3 km vom Ort Heiden entfernt liegen die „Düwelsteene“ / Teufelssteine, die Reste eines steinzeitlichen Großsteingrabes der „Trichterbecherkultur“. Ob das bei der Namensvergabe ein Dorf der Heiden oder eines in der Heide war, ist nicht mehr zu ergründen. Doch, dass in den Teufelssagen meist auch ein Restchen christenmissionarische Wodan-Verhetzung mitschwingt, steht fest. Der Pferdefuß verweist darauf, war doch dem Wodan das Ross so heilig wie dem Christengott das Schaf („Agnus Dei“ = lat. Lamm Gottes). Die Legende, als pfäffisch ausgedachtes Lehrstückchen, berichtet: „Der Teufel schleppte Steine nach Heiden.“ Der Teufel spielt im westfälischen Volksglauben dieselbe Rolle wie anderswo auch. Ein in Heiden ansässiger Schusterjunge begegnete dem Teufel, der auf dem Weg nach Aachen war, um den dortigen Dom zu zerstören. Er trug auf dem Rücken einen großen Sack mit den heute in Heiden liegenden Steinen. Der Schusterjunge hatte zwölf Paar zerschlissene Schuhe bei sich. Der Teufel fragte ihn, wie weit es noch bis Aachen sei. Der Schusterjunge, der die Steine gesehen hatte, erkannte den Teufel an seinem Pferdefuß und erahnte dessen Absichten. Deshalb habe er dem Teufel die Schuhe gezeigt und erklärt, dass er selbst gerade aus Aachen komme und auf dem Weg nach Heiden all die Schuhe zerschlissen habe, weil es soweit entfernt sei. Der Teufel sei daraufhin so entmutigt gewesen, dass er die Steine auf den Boden geworfen und von dannen gezogen sei.

Im Jahre 772 eröffnete Frankenkönig Karl, den die Kirche zum Dank für seine Massenmorde an Heiden heilig gesprochen hat, militärische Operationen bzw. seine imperialistischen Umwälzungen gegen Sachsen und ließ deren Nationalheiligtümer zerstören. Im äußersten Süden des sächsischen Engern-Gaues, an der Grenze zum Herzogtum Franken, thronte in stolzer Höhe auf einem Tafelberg die Eresburg, die „Feste des Himmelsgottes“. (Abb. Eresburg und Marsberg um 1670) Eresburg = „Burg des Eres“ aus Wortstamm ahd. „her“, nhd. hehr / Herr = erhaben, würdevoll, glanzvoll, herrlich [Herrgott]; die in der Mitte wohnenden Germanen laut Tacitus: „Herminonen“; bairisch: „Ertag / Erchtag“ für Dienstag, altnord. „tysdagr“, norweg. „tirsdag / tysdag“, allemann. „Zischtig / Zischdi“, ahd. „Ziestag“ von germ. Himmelsgott „Herr Tiu / Ziu“.
Diese Grenzburg soll Sitz des Cheruskerfürsten Segestes gewesen sein, wo er seine schwangere Tochter Tusnelda, gefangen hielt, um ihre Liebe zu Armin, dem Sieger in der „Varusschlacht“ im Jahre 9 n.0, zu brechen. Der ehrlose, irregeführte Römerfreund übergab sie schließlich dem feindlichen Heerführer, der sie als Trophäe fort- und in seinem Triumphzug der Stadt Rom vorführte. Ihr Vater Segestes wohnte diesem widerlichen Schauspiel als Ehrengast bei. Wie viel Schande und wie viel Leid hat dieser Eresberg schon ansehen müssen ?! Er liegt südlich von Paderborn im nordöstlichen Teil des Sauerlands in Nordrhein-Westfalen. Zur freien sächsischen Zeit galt er als bedeutender Kultort, von dem es in den „Fränkischen Reichsannalen“ zum Kriegsbeginn „Karls des Großen“ heißt: „Er eroberte die Erisburgo und gelangte an den Ort, der Ermensul heißt, und setzte diese Orte in Brand.“ Die Sachsenkriege währten ja eine Weile, aber schließlich wurde im Burgbezirk wurde eine „St. Peterkirche“ errichtet, die als missionspsychologisches Gegenangebot zur Verdrängung des Gottes Donar gedacht war. „St. Peter“ galt als der „Donnerer“ in der klerikalen Konzeption. Dieser Kirchenbau war einer der ersten in Sachsen und das „Kloster Obermarsberg“ eines der ersten Klöster in Westfalen. Von diesem Kloster aus wurde die Umgebung stabsplanmäßig christianisiert. Wohin bei Kriegsbeginn der fränkische Heereszug weiterwalzte, um die Irminsul zu zerstören, ist einigermaßen zu ergründen. Er könnte ins Eggegebirge zur 380 m hoch liegenden Iburg marschiert sein, die östlich von Paderborn beim heutigen Bad Driburg ins Land trutzte. (Abb. Driburg u. Sauerbrunnen mit Allee, 1672) Die volkstümliche Legende jedenfalls ist sich sicher, dass das sächsische Heiligtum hier seinen Standort gehabt haben müsse. Und da wir aus anderen Quellen wissen, dass Karl nur wenige Meilen von der Iburg entfernt, am „Bullerborn“, einer intermittierenden Quelle bei Altenbeken lagerte, bevor er an den darauffolgenden Tagen den Irminsul-Tempel erreichte und zerstörte, gewinnen wir eine bedingt sichere Auffassung. Wie die Quellen berichten, erbeutete Karl den Tempelschatz, namentlich eine beträchtliche Menge des Goldes und des Silbers.

Der Mönch „Rudolf von Fulda“ (gest. 865) gab in seiner Schrift „De miraculis sancti Alexandri“ (Kap. 3) eine Erklärung zur Beschaffenheit der Irminsul ab: „Sie verehrten auch unter freiem Himmel einen senkrecht aufgerichteten Baumstamm von nicht geringer Größe, den sie in ihrer Muttersprache ,Irminsul‘ nannten, was auf lateinisch ,columna universalis‘ [All-Säule] bedeutet, welche gewissermaßen das All trägt.“ Der kosmischen Säule Namen erklärt sich aus ahd. „irmin“ = hoch / erhaben / groß. Eine Petruskirche wurde hier schließlich eingerichtet, die erste Kirche auf sächsischem Boden. Auf Bitten des Papstes Leo III., der die altheilig-heidische Stätten in der Verfügungsgewalt des Klerus haben wollte, schenkte 799 der Frankenkönig seiner Paderborner Kirche die Iburg, die auch „Archidiakonatskirche“ wurde. Vom Rastplatz Bullerborn bei Altenbeken sind es allerdings auch nur ca. 15 km bis zu den „Externsteinen“ (alte Schreibweisen: Eggster-, Eggester-, Egistersteine), den grandiosen Sandsteintürmen im Teutoburger Wald beim heutigen „Horn-Bad-Meinberg“. Auch hier gab es ein altsächsisches Heiligtum von großer Bedeutung, wie es das Anfang 12. Jh. aufwendig eingearbeitete 5,5 m hohe Felsenreliefder „Kreuzabnahme“ beweist, aber auch all die Rätsel wie die Treppenfelsen, die Grotte, die gesprengte Höhenkammer und ihr rundes Felsenfenster, das auf den Aufgangspunkt der Sonne zur Sommersonnenwende ausgerichtet ist, dem allein im Altglauben eine Bedeutung zugemessen war. Kaum vernünftig einzuordnen ist zusätzlich die Gemeinde Irmenseul (bei Harbarnsen) im Harzer Vorland, nordöstlich von Paderborn, um 70 km Luftlinie von Altenbeken entfernt. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1298 als Ermensulle. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass dort eine Tempelanlage vorhanden gewesen sein könnte. Und der Abtransport einer Irminsul-Trophäe ins Reichskloster Fulda hätte keinen derartige Umweg nach Norden gerechtfertigt.
Laut „Lorcher Annalen“ eroberte 775 das Frankenheer die um 700 errichtete Sigiburg, wo die Falen ihr Siedlungsgebiet hatten, die zum sächsischen Stammesverband gehörten. Es handelt sich um die heutige Hohensyburg auf dem Syberg, oberhalb der Flüsse Ruhr und Lenne. Der heroische, offensichtlich charismatische Freiheitsführer Widuchind kommandierte damals die Burgbesatzung. Die auf der Bergsitze innerhalb der Burg errichtete „St. Peter“-Kirche ist 776 von den „Annales Laurissenses maiores“ erwähnt worden. Die Kleriker haben sie künstlich zum Wallfahrtsort und zur „Ablasskirche“ aufgewertet. „St. Peter“ ist in aller Regel den Missionierungsopfern als Ersatz für den Himmelsgott Donar angeboten worden. Wie archäologische Untersuchungen mittlerweile ergaben, wurde mit ihr ein früheres germ. Kultgebäude überdeckt. „Eine Parallele zu dieser Grundrissform besitzt der quadratische Tempel von Uppsala in Südschweden, der wie die Anlage von Haltern bei germanischen Kulthandlungen Verwendung fand. Dieser Tempel war nicht aus Stein und Lehm gebaut, sondern aus Holz. Der Tempel von Uppsala gehört der nordischen Spätzeit an und wurde vermutlich im 10. Jahrhundert errichtet. Diese Parallele ist ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei dem Vorgängerbau der romanischen Peterskirche um ein germanisches Kultgebäude handelt.“ (Detlev Rothe, „Die Hohensyburg im Lichte neuer Frühgeschichtsforschung“, 1979) Auch bei dem hier gezeigten „Petersbrunnen“ handelt es sich um ein altgläubiges Heiligtum, ihn soll Papst Leo III. bei seinem Besuch 799 geweiht haben, eine typische Handlung die an ein christianisiertes früheres Quellenheiligtum denken lässt. Bereits 1887 entdeckte man hier ein erstes von mittlerweile mehreren jungsteinzeitlichen Steinbeilen. So uralt bezeugt sich der Donar-Kult bzw. die Weihestätte des Himmels- und Hammergottes auf dem Syberg.
Sturmi(us) war der Mann der sich bedingungslos in den Dienst der gewaltsamen karolingischen Christianisierungspolitik gestellt hatte und daraus auch seinen persönlichen Nutzen zog. Als hemmungsloser und unbedenklicher Missionar, Gründer und erster Abt des Klosters Fulda, das er sich an einer Furt über den Fluss Fulda von der Staatsmacht erbauen ließ („Karlmannstiftung“), erhielt er 774 für seine Abtei von „Karl dem Großen“ absoluten Königsschutz und damit den Status eines „Königsklosters“ bzw. einer „Reichsabtei“. Mit dem längsten und grausamsten der Feldzügen die der Frankenkönig unternahm, solidarisierte sich der der „fromme Mann“ problemlos. Nichtchristen gegenüber kannte man keine Gnade, sie besaßen keinerlei Menschenrechte. Zum „Blutgericht von Verden“ an der Aller kam es als Karl die sächsischen Großen an die Stelle der Mündung der Aller in die Weser befahl und ultimativ die Auslieferung die Anführer des Freiheitskampfes forderte. In den „Annales regni Francorum“ vom Jahre 782 heißt es: „zur Hinrichtung [wurden] ausgeliefert 4.500 [Sachsen]; was auch so geschehen ist.“ Die Masse der Sachsen war trotzdem nicht willens ihre Freiheit und ihren Glauben fahren zu lassen, so eine Art Friedhofsruhe trat erst ein, als König Karl im Jahre 805 die gesamte Bevölkerung zwischen Weser- und Elbemündung deportieren ließ. Viele Ortsnamen zeugen bis heute von diesen erzwungenen Neuansiedlungen entwurzelter Sachsen. Davon zeugen ein Sachsenhausen in Hessen, Wildsachsen zwischen Frankfurt und Wiesbaden, ein Hohensachsen an der Bergstrasse, Grosssachsenheim in Württemberg, Sachsenried im Allgäu.

Irminsul-Christus-Säule der Krypta zu Fulda
Zwei Jahre vor des Sturmi(us) Fuldaer Klostergründung, noch unter Karl Martell (688-741), war auf einer Kirchenversammlung die neue Taufformel beschlossen worden, nach der die germ. Götter ausdrücklich zu Teufeln verdammt wurden. Und 797 erließ „Karl der „Große“ das berüchtigte „Capitulare Saxonicum“, wonach jeder des Todes sterben sollte, der die Taufe verweigerte, das heißt, kein Christ werden wollte. Schon Karl Martell überzog mehrere Male die Sachsen mit Krieg, dann unternahm „Karl der Große“ von 772 bis etwa 804 die endgültige Sachsenunterjochung, wie ich es dargelegt habe. Der Abt von Fulda, Sturmi(us) zog getreulich mit im Heereszug an Karls Seite gegen die Irminsul. Es muss ihm ein großes Vergnügen bereitet haben, das heidnische Stand- und Sinnbild fallen zu sehen. Was liegt näher, dass er sich mit seinen mönchischen Gesellen die Genugtuung verschaffte, eine Siegestrophäe nach Fulda zu schaffen ?! So war es und sie ist gefunden. Auf einem nördlich vom heutigen Fuldaer Dom gelegenen Hügel, dem „Michaelsberg“, auf dem mancher Sachkenner schon wegen des Namens ein früheres Wodan-Heiligtum vermutet, entstand 822 die Friedhofskapelle des Klosters, die man als Nachbildung der Anastasis-Rotunde, der sog. Grab-Christi-Kirche von Jerusalem, mit dem „Heiligen Grab“ in der Mitte, errichtete. Die acht Säulen des Rundbaues sollen, wie der Urkundenschreiber in karolingischer Ära, der Dichter und Maler des Klosters Fulda Brun Candidus (um 775-845) angab, die acht Seligpreisungen versinnbildlichen. Sie trugen einen niedrigen, mit einem großen Stein abgedeckten Turm. Das gesamte Kapellengebäude ist gegründet auf einer Unterkirche, einer Krypta, die eine einzige tragende Mittelsäule mit „ionischem Spiralkapitell“ enthält. (Abb. Irminsul-„Christus“-Säule) Es handelt sich aber um keinen echten ionischen Säulenkopf, vielmehr um einen solchen in dessen Vor- und Rückseite jeweils eine von einander abweichende Doppelspirale eingraviert worden ist. Das ist etwas sehr viel anderes als ein Ionisches Kapitell. Die Doppelspirale des Säulenhauptes symbolisiert nach altgläubiger Vorstellung die auf- und absteigende Sonnenbahn des Nordhimmels, die sich in entgegen gesetzter Richtung um die gedachte Weltsäule im höchsten Norden, welche „alles trägt“, alljährlich vollzieht. Wie wäre es vernünftig erklärbar, dass der in Stein gebildete sächsisch-germanisch-altgläubige Weltenbaum-Sonnenmythos Verwendung fand, um darauf eine Christenkirche zu errichten ? Mit Sicherheit gab es in sächsischen Gauen nicht nur ein einziges Kultbild der All-Säule. Entweder das Hauptkultbild, oder ein Bruchstück davon, oder eine der weiteren Kultbildsäulen werden sich die triumphierenden Fuldaer Mönche vom Unterwerfungszug ihres Beschützers, König Karl, als köstliches Souvenir nach Fulda mitgenommen haben. Sie werden es versteckt gehütet haben, sinnbildlich beerdigt haben, unter die Erdoberfläche gedemütigt haben und - nach gängigen Vorstellungen damaliger Zeit - entdämonisiert bzw. vereinnahmt haben. Eine eindeutige Bestätigung dafür muss die Erklärung der Bausymbolik der Michaelskirche durch Brun Candidus erscheinen, der die Anlage in seiner Biographie des Abtes Eigil (750-822) beschrieb, welcher ein Schüler und Neffe Sturmis war und Erbauer der Kapelle. Candidus allegorische Interpretation deutet die Säule als Sinnbild für Christus (!) der das Weltall trägt. Da hört man die krampfhafte verschristlichende Umdeutung altgläubiger Anschauungen heraus. Dass es zur Zeit der Erbauung nötig schien, diese gedrungene, unterhalb der Bodenlinie stehende Säule durch eine derartige weitgehende, überhöhende Sinngebung herauszustreichen und zu ihrer Ausdeutung die Majestät der höchsten Figur des neuen Glaubenskonzeptes in Anspruch zu nehmen, gibt zu tiefstem Verständnis Anlass: Aus höchster heidnischer Allegorie der „All-Säule“ erfolgte die Umdeutung aus christlicher Logik, zur höchsten Glaubensidee des „Gottessohnes“. Warum sollte auch in einer Zeit des romkirchlichen Triumphes, gedeckt durch die karolingische Staatsmacht, eine Säule, welche den Auftrag hat, den das All tragenden christlichen Erlösergott, zu versinnbildlichen, unter die Erde verbannt werden, um ausgerechnet darauf das Grab eben dieses „Erlösers“ in einer Nachbildung zu errichten ? Folgerichtig und sinnfälliger wäre die Anordnung in umgekehrter Reihenfolge, nämlich eine Krypta in Form der Grabeskirche, auf der sich die „christliche Erlösergottsäule“ triumphierend in den Himmel streckt. Die Krypta war das Beinhaus der Möche, hier, bei der beerdigten Irminsul lagerten sie sinnigerweise auch die Gebeine ihrer Toten. Es darf also als sicher gelten, dass die Krypta der Michaelskirche zu Fulda eine altgläubige Irminsul birgt. (G. Hess, „Eine altgläubige Kultsäule unter der Michaelskirche zu Fulda“, in „Mitteilungsbl. d. Arbeitskreis. f. Ur-Sinnbildforschung e.V.“, 1984)
Unter den Osnabrücker Bischöfen Benno I. und II. (1052-1088) ist auf altsächsischen Ruinen der Driburg die neue Burg- und Klosteranlage errichtet worden. Diese war Mittelpunkt des mönchischen Lebens im Bistum Osnabrück, bischöfliche Residenz und wichtigster Militär- und Verwaltungsstützpunkt beim Aufbau des kirchlichen Territorialstaates. Es ist erstaunlich folgerichtig, dass Deutschlands zweitgrößte christenkirchlich organisierte ca. 80-km-Fußwallfahrt (hinter der von Altötting), von der altgläubigen Asenhochburg Osnabrück zu einem pappelhölzernen „Gnadenbild in Telgte“ (Christus-Leichnam im Schoß seiner Mutter) zurückgelegt wird. Solche Wallfahrten waren und sind letztlich nichts als Machtdemonstrationen der Christenkirche, die damit ihren Herrschaftsanspruch über die Region und deren Menschen immer aufs Neue kundtun möchte. Damit sich genügend Pilger daran beteiligen, gebraucht man unverdrossen jenen billigen Schwindel mit dem gewährten Sündenerlass. Und genügend unweise Leute glauben noch heute solchen unaufrichtigen Versprechungen. Der Demonstrationszug, durch eine Hauptgegend altheimischer Frömmigkeit, geht von Osnabrück aus nach Oesede, einem alten Klosterstandort, weiter nach Süden über Iburg nach Glandorf mit seiner Kirchhofsburg, dann zum Rittergut Oedingberge, wo an der dortigen Klause die erste Rast mit „Wortgottesdienst und Predigt“ eingelegt wird.

Die Wewelsburg, nicht weit südwestlich von Paderborn, ist Deutschlands einzige Dreiecksburg. (Abb. Wewelsburg, 1672) Unterziehen wir sie und ihr Umland einer genaueren Untersuchung. Sie ist nur ca. 20 km Luftlinie von Marsberg entfernt, wo „Karl der Große“ den altsächsischen Höhentempel zerstörte. Auch nur ca. 20 km vom nordwestlich gelegenen Esebeck bei Lippstadt, dessen Urnamen wohl Asen-Bach war, wie es von niedersächsischen Orten dieses Namens bezeugt ist. Ihr alter Name war 1123 Wifilesburg, ein Begriff der nur ableitbar ist von dem Grundwort „Weib“, aus ahd. wïb, niederl. wijf, engl. wife, schwed. viv, bzw. ahd. wifan, nhd. schwingen / winden / weifen, woraus das Weib etymologisch als „Die-sich-hin-und-herbewegende“ zu begreifen ist. Aus Wifil bzw. Weibelsburg ist im Laufe der Zeit Wevel und Wewel bzw. Wewelsburg geworden. Einen verwandten Namen führt die Ortschaft Wewelsflethan der Elbmündung (Kr. Steinburg), die man 1238 als Weuelesflethe schrieb. Fleet / Fleth ist die Bezeichnung eines natürlichen Wasserlaufs in den Elbmarschen. Das Wort Wewel führt man auf Wibil zurück, so dass jener Fleet im Besitz eines oder einer Wibil war. Daraus sei im Laufe der Zeit Wevel / Wewel geworden. Naheliegender, als einen Männernamen zu unterstellen, ist es, das Wort im femininen Sinne zu deuten. Auch Wewer (835 Wawuri, 12. Jh. Waveri / Wevere), ein südwestlicher Stadtteil von Paderborn, möglicherweise aus einem germ. Dialekt der Marser, Brukterer, Cherusker, Falen oder Sachsen ist gleichermaßen zu erklären. Die gräflichen Brüder Haold gründeten 946 im 10 km von Paderborn entfernten Geske „zu Ehren der heiligen Jungfrau und des heiligen Cyriakus“ einen Damenstift, dessen Äbtissin ihre Schwester Wichburg (oder: Wicsuit / Wigswid) wurde. Alfen (1031 Alflaan) im Kreis Paderborn trägt seinen Namen von altgläubigen Zeiten her, denn Alf-Laan bedeutet Seelen-Land bzw. Bezirk in dem sich die Ahnengeister wohl fühlen. Ob Wadersloh, nördlich Lippstadt nicht einstmals ein Wodanslo war ? Das südlich der Wewelsburg liegende Weiberg könnte aus einer früheren Form Weib-Berg gebildet sein, denn die hiesige Kirche „St. Birgitta“ wird wohl von iroschottischen Wandermönchen gegründet sein, die auf die Ortstraditionen Rücksicht nehmen mussten. Dass wir es bei dem die Region bestimmenden Paderborn mit einem ursprünglichen Mutterkultort zu tun haben, wird bei näherer Betrachtung zunehmend klarer. Das Element Wasser und insbesondere die Quellen, wo die heilwirksame, lebenspendende Feuchte aus dem Erdmutterschoß ans Licht tritt, waren die Weiheorte der Feen, der Nymphen, der Göttinnen. Der kurze Fluss Pader entspringt im Paderquellgebiet inmitten Paderborns und mündet schon nach 4 km in die Lippe, deren Quelle nicht weit entfernt ist. In Paderborn sprudelt und plätschert es aus über 200 kleinen Quellen in mehreren heute ummauerten Quellbecken. Flüsse, Bäche und Quellen der Ems, Lippe, Heder, Afte und Alme bestimmen diese Landschaft. Paderborn muss als mutterkultische Hochburg des Altglaubens geschaut werden, deren Wirkung das Umland - bis hin zur Wewelsburg - mitbestimmte. Um 777 entstand unter dem militärischen Zwang des Frankenreiches dann eine Missionskirche, die auf das Land Westfalen befriedend einwirken sollte. Der Segen des Himmels schien auf dem Bau nicht zu ruhen, er ist fünfmal abgebrannt, doch immer wieder bis zum heutigen Dom neu hergerichtet worden. Die Figur der „Muttergottes“, als eine Mitpatronin, steht in der Vorhallenmitte, sie ist eine der frühesten stehenden Madonnen in Deutschland. An der Südseite, die Marienkapelle, ist die größte und vermutlich älteste der hiesigen Domkapellen. Auch „Brigida von Irland“, der wir in Weiberg begegneten, war eine gewisse Zeit ebenso Mitpatronin der Kirche, ihr ist eine weitere Kapelle geweiht. Dazu wird mit „Doppelmadonna“, „Margarethenaltar“ und „Elisabethkapelle“ jenen Gläubigen, die weibliche „Heilige“ bevorzugen, ein reichhaltiges Angebot gewährt. Wenn die Wewelsburg auf einem Traditionsgebiet des Mutterkultes entstand, dürfte ihre Dreiecksform möglicherweise als Reminiszenz an das mütterliche Urgestirn der „Der Drei“, der drei Matronen, der Nornen, der Schicksalsmütter erahnt werden ? In ihrer heutigen Form ist sie ab 1603 vom Paderborner Fürstbischof Dietrich Fürstenberg errichtet worden, doch ihr Vorgängergebäude war als Schutzburg geplant und geht auf das 9. Jh. zurück, in jene graue Phase, in der die hunnischen Ungarn bis hierher ihre Raubzüge unternahmen.
Um 40 km nordöstlich der Wewelsburg liegt Rheda (Krs. Gütersloh), 1085 erstmals urkundlich erwähnt. Auch das war eine Heimstätte des Mutterkultes. Nach des angelsächsischen Historikers und Kirchenmannes Beda-Venerabilis Auskunft, war der März der angelsächsischen Göttin Rheda geweiht und hieß Rhed-monath. Die im keltischen Alpengebiet siedelnden Räter bildeten eine Kultgemeinschaft der Fruchtbarkeitsgöttin Rhetia / Reitia. Die Große Mutter als Triade zu verehren, in Gestalt der „Drei Heiligen Madln“ bzw. der Aubet / Cubet und Quere / Ainbet / Gwerbet und Wilbet war bis ins Hochmittelalter üblich, ebenso wie im Wormser Raum. „Die große Bedeutung der Matronenkulte zeigt sich in der Zahl ihrer Tempel und Weihungen, die der Summe aller übrigen gleichkommt. Matronen waren Ahnengöttinnen und Fruchtbarkeitsgöttinnen mit über 100 verschiedenen Epiklesen, die ihr Wesen, Geländenamen / Flurnamen / Baumnamen oder Personalverbände bezeichnen.“ (Frank Biller, „Kultische Zentren der Matronenverehrung in der südlichen Germania inferior“, 2010) Gute 40 km Luftlinie südwärts der Wewelsburg liegt im Hochsauerlandkreis das Gebiet um Medebach an der „Heidenstraße“, eine Region die zum altsächsischen Gebiet gehörte. (Im Thüringischen wiederholt sich dieser Ortsnamen.) Als die östlichste der zwölf Urpfarreien in Südwestfalen ist es zu einer gut befestigten missionsaktiven Pfarrei ausgebaut worden. Etwas südlich davon ist Medelon. Auch diese beiden Begriffe könnten an Mütter- oder Maiden-Verehrung erinnern. Sie könnten aus einer alten Begriffsform der lat. Matres, der jungfräulichen Mütter, „Hl. Jungfrauen“, von Maiden, Jungfern, niederl. Magdeken, nhd. Mädchen, entstanden sein. Zudem ist Meduna der Name einer kelt.-germ. Göttinnen-Inschrift eines Weihesteines von Bad Bertrich in der Eifel. 15 km östlich von Medebach, mit dem alten Flurnamen „Frauenbruch“, einem heutigen Naturschutzgebiet, liegt Marienhagen, dazwischen Goddelsheim mit ehemaliger Goddelsburg. Ca. 6 km nördlich davon befindet sich die Stadt Korbachim Ittergau, die aus altfreier Sachsenzeit urkundlich 980 Curbechi hieß, abgeleitet von „Cor“ oder „Cur“ von „Kür“ bzw. küren, nhd. Wahl, wählen. Korbach galt also zur altgläubigen Zeit als ein „Versammlungs- u. Wahlplatz am Bache“. Ein „Graf Asicho vom Ittergau und Nethegau“ wurde in o.a. Urkunde genannt. Die vorchristlichen Sachsen hatten eine urdemokratische Verfassung, die sich in der Volksversammlung selbstbestimmter Männer, dem Thing, als politisches Fundament äußerte. Deshalb ist es nicht überraschend, dass „Karl der Große“ nach seiner Unterjochung und dem Beginn des kirchenchristlichen Zwanges, die Eingliederung der Sachsen in das Fränkische Reich dadurch einleitete, dass er ihre Grundverfassung zerstörte, indem er strickt jede allgemeine Volksversammlung verbot und sie nur zuließ, wenn er einen entsprechenden Antrag erhalten und ihn genehmigt hatte und sie von seinen Königsboten einberufen wurde.
Die „Heidenstraße“ war eine über Jahrtausende alte, rund 500 km lange Heer- und Handelsstraße, die auf direktem Weg von Köln über Kassel, Leipzig bis Breslau und Thorn führte. Über diesen Verbindungsweg kamen oftmals Missionare in die heidnischen Gebiete, so sind die zahlreichen Urpfarreien entlang der „Heidenstraße“ erklärlich. Von Medebach westlich in Richtung Köln liegt das sauerländische Oedingen im Tal an der Westflanke vom Oedingerberg, südlich Eslohe. Es ist schon für das Jahr 1.000 urkundlich belegt und zählt, zusammen mit dem etwa gleich alten Elspe, zu den ältesten Orten des Kreises Olpe. Oedingen war Sitz des Freigerichts für die Grafschaft. Eine adelige Dame namens Gerberga errichtete zur Beurkundungszeit ein adeliges „Damenstift Oedingen“ auf dem Oedingerberg innerhalb des Bezirks der altsächsischen Wallburg, was in den Zeitläufen dahinsichte, entweder aus Mangel an Adel, oder wegen abnehmender Freude an der verordneten Jungfräulichkeit. Im Jahre 1538 wurde es aufgelöst, weil nur noch 2 Jungfern lebten und ihre wirtschaftlichen Verhältnisse desolat waren. Ebenso eine klösterliche Einrichtung für Frauen war Odacker vor den Toren der Stadt Hirschberg südwestlich von Warstein. Im Jahr 1585 wurde Odacker erstmals zerstört. Zur Versorgung der Nonnen schenkte ein Kölner Kurfürst dem Kloster 1601 Unterhaltseinahmen aus einer kirchlichen Anlage bei Oedingen. Im 12. Jh. wird erstmals ein „Odacher iuxta Arnesberg“ erwähnt. Die Bedeutung des kleinen Ortes wird aus einer Kölner Grenzbeschreibung in dieser Zeit ersichtlich. Odacker erscheint dort als einer der Grenzpunkte zwischen dem westlichen Teil des Arnsberger Waldes und dem östlichen Teil, dem Osterwald, den die Erzbischöfe von Köln beanspruchten. Odacker liegt 30 km südwestlich der Wewelsburg und ca. 25 km nordwestlich von Medebach. Südwestlich von Oedingen strecken sich die Höhen des Rothaargebirges, dessen Berg, der „Kahle Asten“ eine Höhe von 841,9 m hat. Am Südhang, nahe am Astengipfel, befindet sich der „Helleplatz“ mit der Odeborn-Quelle. Nördlich davon, zwischen Medebach und Oedingen, liegt das zwischen 600 und 700 m hochgelegene Dörfchen Osterwald, auf einem Ausläufer des Rothaargebirges. Sein Name erscheint wenig plausibel, wenn wir unterstellen, er sei nach Gesichtspunkten der Himmelsrichtung erfolgt. Könnte, so abseits und versteckt, ein ursächsischer Oss-Ort namentlich überdauert haben ? Ein Naturschutzgebiet Osterwald liegt allerdings tatsächlich östlich der Stadt Espelkamp (Krs. Minden-Lübbecke). Ein Osterwald ist mit 800 Hektar das größte zusammenhängende östliche Waldgebiet der Halbinsel Zingst, westlich von Rügen. Ein Osterwald liegt westlich von Lingen an der Ems. Osterwald heißt auch ein Höhenzug des Calenberger Berglands (Teil des Weser-Leine-Berglands), an seinem Südrand befindet sich das gleichnamige Dorf. Auf einem spornförmigen Ausläufer des Osterwaldes steht die Barenburg, eine alte Wallburganlage. Eine Gemeinde Osterwald (Lkr. Grafschaft Bentheim) liegt nördlich von Neuenhaus. Ein Osterwald ist Stadtteil der Stadt Garbsen im Bezirk Hannover. Ein Osterwald (Lkr. Hameln-Pyrmont) ist im nördlichen Ortsteil von Salzhemmendorf. Die Siedlung liegt am Südhang des gleichnamigen Höhenzuges Osterwald. Ein Osterwald ist Ortsteil von Aßling (Lkr. Ebersberg), gehörend zur Region München. Es wurde 18.09.778 als Azzalinga erstmals urkundlich erwähnt. Assling gibt es auch im Osttiroler Pustertal. Ein Osterwald ist Ortsteil der Gemeinde Böbing (Lkr. Weilheim-Schongau). Ein Osterwald ist Ortsteil der Marktgemeinde Dietmannsried (Lkr. Oberallgäu). Allerdings passen die süddt. Osterwälder nicht in das sprachgeschichtliche Schema der Ass-Oss-Orte hinein ! Doch aber jener der „Saalhauser Berge“, ein Gebirgszug im Sauerland des Kreises Olpe. Ihr Südwest- und Mittelteil gehört zum „Naturpark Rothaargebirge“; im östlichen Ausläufer erhebt sich der Ösenberg mit 678,8 m. Wohl ist er weit entfernt davon, der Oseberg-Hof, wo man auf dem Oseberg-Gut („Lille Oseberg“) dicht am Ufer des norwegischen Oslofjords das sog. „Oseberg-Schiff“ ausgrub. Bis heute stellt das stolze Schiff den reichsten und wichtigsten Fund aus der Wikingerzeit dar. Die dendrochronologische Analyse ergab, dass das Schiff aus im Jahre 820 gefällten Eichen gezimmert wurde und dass die Grabkammer aus dem Jahr 834 stammt. Damals waren die Beziehungen zwischen den Sachsen-Gauen und dem skandinavischen Lebens- und Sprachraum noch verwandtschaftlich eng, der „Eiserne Vorhang“ der karolingischen Missions- und Gewaltpolitik begann erst ab dieser Zeit seine unheilvolle Wirkung zu entfalten.
Zurück in die heimatlichen hessischen Gaue: Nordöstlich von Koblenz an Rhein, nördlich von Montabaur liegt die kleine Siedlung Ötzingen (1362 Ozingen, 1385 Oezingen, 1386 Oitzingen, 1417 Oytzingen, 1476 Uitgzingen, 1476 Otzingen, 1589 Oezingen) mit ältester Schreibweise Ozingen, also der Urlautung Otingen, denn den Buchstaben „z“ gab es in germanisch-deutscher Vorlateinperiode nicht, handelt es sich um ein echtes Od-Dörfchen, d.h. einer Kultstätte der altdeutschen Od-Religion (Wodan, Godan, Odin, Goð, Gott), denn „t“ und „z“waren in Lautwert und Schreibweisen variabel. Die Westerwald-Gemeinde liegt am Fuße vom 422 m hohen Malberg, einem längst erloschenen Vulkan, der höchsten Erhebung der Montabaurer Senke. Am Rande seines Gipfelplateaus finden sich die Reste von drei frühgeschichtlich-keltischen Ringwällen. Als ab dem ersten Jh. v.0 die Region zunehmend germanischen Siedlern zur Heimat wurde, ist der markante Bergkegel zur Malstätte d.h. Volksversammlungs- bzw. Thingplatz geworden. Der beste Nachweis dafür ist außer dem bezeichnenden Begriff Malberg auch die Malbergkapelle am Osthang (Sonnenaufgangsseite), denn Feldkapellen wurden während der Missionsphase kirchlicherseits allein dort errichtet, wo heidnische Heilsstätten entdämonisiert und mithin geweiht werden sollten. Die heutige Malbergkapelle ist erst 1892 errichtet worden, von einem Vorgängerbau ist bisher nichts in Erfahrung zu bringen gewesen. Markante Basaltürme und weitere wunderschöne Felsformationen, die überall aus dem Boden aufragen,findet der Wanderer bei seiner Rundtour. In Kapellennähe liegt der „Helje Brunn“,ein früher als Heilquelle genutzter Born. Wie könnte es anders sein, dass sich um den altheiligen Malberg und seine Felsgebilde die Legenden ranken. Ein Felsgebilde heißt der „Huhe Fils“ (Hoher Fels ?) mit seinem Wackelstein und dem „Richterstuhl“, einer Stätte an der offenbar einstmals reguläres Gericht gehalten wurde oder auch die Feme stattfand. Eine der Spalten wird im Volksmund Wildweiberhäuschen genannt. Dort sollen drei wilde Frauen gehaust haben, die als Hexen verschrien waren und gelegentlich in den umliegenden Dörfern umhergingen. Im nahen Moschheim trieben sie am Sonntag wenn niemand zu Hause war ihr Unwesen. Sie stifteten Unordnung, stahlen oder legten Feuer in Schuppen, doch seltsamerweise wurde nie großer Schaden angerichtet. Die „wilden Weiber“ sollen den guten Menschen jedoch hilfreich gewesen sein. Es wird erzählt, die Hexen hätten oftmals in der Nacht den Witwern in Leuterod die gesamte Hausarbeit erledigt. Eines Tages wären sie plötzlich verschwunden und niemand hat danach wieder etwas von ihnen gehört. Eine andere Sage erzählt von einer weißen Hexe, die zwischen den Felsen hauste. Gelegentlich hallte in der Nacht gewaltiger Krächzen und Geschrei vom Malberg hinunter, so dass sich mancher fürchtete. Dann, so munkelt man, fahre die weiße Hexe aus dem Wildweiberhäuschen aus. Demnach war der Malberg auch einer der sogenannten Frauenberge, von denen wir in den keltisch-germanischen Heimatgauen so viele kennen. In kirchenchristlich bestimmten Zeiten hat man die heiligen weisen-weißen Frauen zu Hexen verketzert, sie galten aber in Heidenzeiten als hilfreiche Feen, Disen, Heilrätinnen, also weibliche Naturgeister und mythologisch-religiöse Gestaltungen, die aus den Vorstellungen der drei Nornen (Parzen, Moiren), den Schicksalsweberinnen hervorgegangen waren und in den römer- bzw. kaiserzeitzeitlichen Jahrhunderten sich zum Drei-Matronenkult oder Mütterkult auswuchsen. Der südhessische Odenwald (627 Otenwalt, 815 Odonewalt), aus „Wald des Woden / Oden“, hat seine skandinavischen Entsprechungen in Onsved (früher Othænsweth auf Seeland in Dänemark), auch in Odenslunda im schwed. Skåne und Uppland, sowie Onslunda in Vestergötland. Unweit von Trier sind zwei eng beieinander liegende Ortschaften aus frühester Besiedelungsphase Edingen und Godendorf. Auch Belgien besitzt ein Edingen (franz. Enghien) und die flämische Gemeinde Oetingen. Ein weiteres Edingen wurde am Unterlauf des Neckars gegründet. Auch gab es ein Edingen bei Neustadt in Westpreußen. Ein Odenbach und Odernheim liegen südwestlich Bad Kreuznach am Zusammenfluss von Nahe und Glan. Hier, auf dem Disibodenberg, der Stätte eines vorchristlichen Heiligtums, wurde seit dem 7. Jh. eine Taufkirche zur Missionierung des Nahe-Raumes errichtet. Im dortigen Kloster hat die berühmte heilkundige Hildegard von Bingen (1098-1179) den größten Teil ihres Lebens zugebracht. Das 30 km östlich befindliche Gau-Odernheim (früher Otternheim), einstmals eine königlich fränkische Domäne mit Burg, wurde am Fuße des Petersberges errichtet, eine der höchsten Erhebungen im rheinhessischen Land. Allein dieser Umstand spricht dafür, dass Otternheim ursprünglich nicht nach dem Wassermarder Otter benamt worden sein wird, sondern auch eine altheilige Od-Ortschaft ist. Um 1.000 errichtete man eine Basilika die dem „hl. Petrus“ geweiht wurde, was als untrüglicher Hinweis dafür verstanden werden darf, dass der Berg in Heidenzeiten dem kelt. Taranis, dem röm. Jupiter, dem germ. Donar geweiht gewesen sein muss, dessen Andenken christliche Eiferer in der Regel mit ihrem „hl. Petrus“ zu überlagern versuchten. Das höchste Bergmassiv der Pfalz, der Donnersberg (lat. „Mons Jovis“), an dessen Fuß Dannenfels liegt, trägt denn auch noch immer ist die Bezeichnung des germ. Wetter- bzw. Donnergottes Donar, der besonders auf Höhen seine Verehrung fand. Auf der Hochebene bauten die Kelten ca. 150 v.0 eines der größten Befestigungswerke nördlich der Alpen, mit Mauerhöhen bis zu 4 Metern.
Im Kraichgauer Hügelland, nahe Bruchsal, liegt das im Nibelungenlied („C-Fassung“) erwähnte Odenheim (im Lorscher-Codex 769 als Otemheim), dessen Geschichte eng mit dem Kloster am Wigoldsberg verknüpft ist. Das Odenheimer Kirchenpatrozinium hat der Wodan-Nachfolger „Erzengel Michael“ inne, er fand auch Aufnahme im Ortswappen. Die 1013. Strophe des Epos lautet: „Von dem selben brunnen do Sifrit ward erslagen sult ir die rehten maere von mir hören sagen: vor dem Otenwalde ein dorf lit Otenheim da fliuzet noch der brunne des ist zwifel dahein.“ Weiter wären zu nennen die alten Residenzstädte Öttingen im nördlichen Schwaben und das bayerische Oettingen im Ries, dazu das lothringische Oetingen. Es gibt reichsdeutsch-bayerische Edelfamilien dieses Namens, z.B. die „Grafen von Ötingen [oder Otingen]“, die „Herren von Öttling“ und „v. Oedenberg“, die österreichischen „Herren von Öth“ („Oedt auf Lichtenau“).
Der bereits besprochene Otzberg ist ein erloschener Vulkan im vorderen Odenwald, ihn krönt die „Veste Otzberg“. Dass sie im Besitz der nordosthessischen Abtei Fulda war macht auch diesen Berg als Od-Kultort verdächtig. Erbauen ließ sie der Abt des Klosters Fulda, Marquard I., der mit dieser und weiteren Burgen im Umkreis seinen Machtanspruch deutlich machte. Unter seiner Leitung wurde durch Mönche seines Skriptoriums die größte aufgedeckte Betrugs- bzw. Fälschungsaktion des Mittelalters zu Gunsten des Klosters durchgeführt („Codex Eberhardi“). Mit manipulierten Urkunden wurden Fuldaer Besitzrechte an Gütern „bewiesen“, die dem Kloster nie vermacht worden waren; die Originale vernichtete man. Zu den ältesten Siedlungen des inneren Odenwaldes, aus vorchristlicher Zeit, zählt Michelstadt, das 741 als befestigter Gutshof Michelnstat, erstmals urkundlich erwähnt wurde. Fürst Karlmann schenkte die Stätte dem Bonifatiusschüler Burkhard, dem späteren Bischof zu Würzburg. Zu Würzburg war noch 689 ein Schwarm Peregrinatios, aus Britannien und Irland gekommene, in späteren Zeiten als „Frankenapostel“ bezeichnete Wandermönche, darunter Kolonat, Totan, Kilian, erschlagen worden, woran leicht zu ermessen ist, wie wenig beliebt die fremde Christenbotschaft den Menschen damals war. Auch Burkard gehörte zu den abenteuerlustigen britannischen Mönchen, die auf dem Festland missionieren wollten und dafür polizeilichen Schutz und Deckung bei der karolingischen Staatsmacht suchten. Die Karolinger ihrerseits waren als Usurpatoren bemüht, eine Legitimation für ihre angemaßte Macht, durch den Papst in Rom zu erlangen. So entstanden derartige Zweckbündnisse der Macht- und Pfründenergreifung, die wir mit dem modernen Begriff der Seilschaften treffend umschreiben könnten. Im Auftrag des fränkischen Hausmeiers „Pippin dem Jüngeren“ reiste Burkard nach Rom, wo er bei Papst Zacharias die Sanktionierung der Absetzung des rechtmäßigen Merowingerkönigs Childerich III. einholen sollte. Die tatsächliche Macht hatte Pippin längst errungen, doch er strebte danach, auch den Königstitel zu erlangen. Der Papst gab dazu seinen Segen, machte er doch damit alle zukünftigen Karolingerkönige abhängig vom päpstlichen Stuhl. Der kecke Hausmeier setzte sich also die fränkische Königskrone auf und verbannte den geschorenen Frankenkönig ins Kloster Prüm. Damit begannen ab 751 die Karolinger ihre legitimierte imperialistische Großraumpolitik, Hand in Hand mit gleichgelagerten Gelüsten der Herren im Vatikan und jenen durchtriebenen Patrizierfamilien Roms, die ihre machthungrige Gier, verbunden mit der römischen Tradition vom Schweiß und vom Blut unterworfener Völker zu leben, nach dem Ausklang des politischen Imperium Romanum fast nahtlos weiterverfolgten, in Gestalt eines katholischen Weltreichs. Das dazu nötige organisatorische Handwerk hatten sie in langen Jahrhunderten röm. Weltdüpierung und -ausbeutung vortrefflich erlernt. Die Karolinger entmachteten „im höchsten Auftrage“ konsequent sämtliche nichtchristlichen Vorbesitzer von Gütern und setzten sich auf die eine oder andere Art und Weise in deren Besitz, während gleichzeitig der römische Klerus ungeheure Schenkungen erhielt -, als ständigen Geldfluss den dem Volk abgepressten „Kirchenzehnten“ obendrein. „Karls des Großen“ Sohn „Ludwig der Fromme“, gab 815 Michlinstat dem im Kloster Fulda erzogenen karolingischen Günstling Einhard zu Besitz. Nach dessen Tod kam der schließlich ans Kloster Lorsch. Der aus alemannischer Zeit stammende Hof Michelnstat weist durch seinen Namen auf Wodan-Verehrung hin, galt er doch als der Michel (ahd. michil = groß, gewaltig, mächtig). In der ca. 20 km Luftlinie entfernten Wüstung Grubingen, etwas nördlich bei Miltenberg, gab es eine Kirche „St. Michaelis“. Der clevere Einhard hatte beabsichtigt, eine einnahmesichere Wallfahrtsstätte im Odenwald zu gründen, wofür er den Kirchenbau (824-827) in Steinbach bei Michlinstat errichtete, die sog. karolingische „Einhards-Basilika“. Den an heidnische Wodanverehrung anknüpfende „St. Michael-Kult“ wollte er insbesondere in Michlinstat keinesfalls unterstützen, damit hätte er an dieser Stelle einer klar ersichtlichen vorchristlichen Tradition entsprochen. Seine Kirche wollte er anderen „Heiligen“ weihen, darum schickte einen Beauftragten nach Rom, um sich Reliquien-Knochen zu beschaffen, welche aus Katakomben-Gräbern der „Via Labinia“ unerlaubt entwendet und herbeigeschafft wurden. Doch bald darauf verließ Einhard „auf Geheiß seiner Heiligen“ Knochen die ihm unholde Stätte und brachte seine Märtyrer-Gebeine nach Seligenstadt, wo er eine weitere Basilika errichten ließ. Ob ihm zu Michelstadt der verteufelte Mercur-Wodan keine Ruhe gelassen hatte ? Denkbar wäre es, denn man fand in der Fundamentschüttung der „Einhards-Basilika“ unter der Treppe des nördlichen Seitenschiffs den Kopf einer geschändeten Mercurius-Statue aus Sandstein. Der etwa 15 cm hohe Kopf scheint, wie Sachverständige angeben, die Arbeit einer einheimischen Werkstatt zu sein, handwerklich besonders gelungen. Der Gott trägt einen freundlichen, fast heiteren Gesichtsausdruck. Um 20 km nördlich von Michelstadt fand man im Forstbezirk des Obersberges, südlich Rai-Breitenbachs, das „Reibacher Bild“, eine keltische Sandsteinfigur. Ebenso fanden sich hier ein röm. Viergötterstein und ein weiterer abgeschlagener Merkurkopf. Wir sehen zunehmend deutlicher, dass der Odenwald seinen Namen zurecht trägt. In seinen röm. Kohortenlagern haben die germ. Hilfstruppen ihren Hauptgott unter der staatlich legitimierten Gestalt des Mercurius geehrt und die folgenden selbstbestimmten Alamannen als Wodan. Auf den Berghöhen und in verschwiegenen Tälern des Odenwaldes muss die Merkur-Wodan-Verehrung über lange Jahrhunderte, bis weit in die christlich-kirchlich bestimmte Ära, geübt worden sein.
Auch weitere Ott- bzw. Otten-Orte, die nicht sämtlich auf den Fischotter (Lutra lutra) zurückgehen, kommen in Betracht. Beispielsweise Medenbach (Krs. Lahn-Dill) liegt am Medenbach, nördlich des Ortes erhebt sich der Berg Otterich (463 m), der sicherlich seinen Namen nicht vom Fischotter bezog. Eher ist eine Entstehung aus Odens-Reich denkbar. Die gewöhnliche Erklärung für die deutschen Namensgebungen ist die, dass der Ortsgründer ein Mann namens Udo / Odo war, während die Endung „-ing“ die Zugehörigkeit zur genannten Person ausdrückt -; mit „-ing“ wurden Insassen- bzw. Nachkommennamen gebildet. Diese Deutung ist im ersten Teil zu hinterfragen, denn sie vermag nicht jene Anlautwandlungen vom „od-„ zum „got-„ verständlich machen. Warum hätte man profane Odo-Siedungen zu God-Namen umformen sollen ?! Auch erklärt das nicht ihre oft auffällige charakteristische Örtlichkeit als Kultplatz. Viel eher wird es sich um Heilsplätze des Wodan-Godan-Odin handeln. Aus dem Begriff Wodan / Wodin wurde im Frühmittelalter sprachgesetzlich, durch Wegfallen des „w“ vor dunklen Vokalen, ein Odan / Odin und aus Kultbergen des Wodan / Woden wurden Odensberge oder Godesberge. Bekanntlich wurde auch der altheimische Wodanstag (lat. diēs Mercuriī, franz. Mercredi, altengl. Wēdnes dæg, Woden's day = Mittwoch) in den vorhandenen Chroniken zum Godenstag, Goenstag, Godisdag, Goidestag, Gonsdag, Gudenstag, Goderdesdach bzw. Gottestag umgeformt. Durch die im südgerm. Raum früher vollzogene Missionierung, und die damit einhergehende gewaltsame Unterdrückung des Wodan, brach die Sprachtradition ab, so dass wir keine weiteren Belege als die Ortsnamen finden können. In Skandinavien verblieb wegen der späteren Verchristlichung genügend Zeit, die Formen Odin bzw. Onsdagr (Wotanstag-Mittwoch), also ohne Anlaut „w“, in die altnord. Literatur eingehen zu lassen. Skandinavische Ortschaften wie Odense (1109 noch Othenswi aus „Odins-Wi“ = Odins Weihtum), Odens und Oddense in Dänemark -, Osland, Odinsland, Odinssalr in Norwegen -, Odenslanda, Onslunda, Odenslanda, Odensvi, Odensaker, Odinshargh, Odensala, Odinshof, Ödeshög (1318 Ödhishögh) im schwed. Östergotland, um einige zu nennen, stehen neben vielen Flurbezeichnungen gleicher Art. In Schweden gibt es den Odensberg, Onsberg, Odenshög -, in Norwegen Odinsberg -, in Dänemark Onshöj, Oddenshöj und viele mehr. Von Niederdeutschland, wo der gleiche Begriff Odin bereits gebräuchlich war, fehlen wahrscheinlich nur deshalb die reicheren Belege wegen den unduldsamen Zerstörungs- und Verbotsmaßnahmen der katholischen Franken im 8./9. Jh.. Nach ihrem Eindringen in Sachsen, im Jahre 772, verwüsteten fränkische Heere, insbesondere ab 785, Landstrich um Landstrich bis zum letzten großen Befreiungsversuch 792 bzw. dem niedergeworfenen Stellinger-Aufstand i.J. 804. Die stark entvölkerten östlichen Elblandschaften überließ man fremden Neusiedlern aus dem Osten. Oden-Gemeinden bzw. -Hofschaften dürften deshalb im dt. Norden kaum mehr zu finden sein. Ein einziges Odisheim existiert im Hadelner Moorland südlich von Otterndorf und ein Godensholt, ursprünglich Wodensholt, in unwirtlicher Gegend im Oldenburgischen. EinOdenbüllgibt es auf der Halbinsel Nordstrand. Doch dürften auch etliche norddt. Os-Orte ein Zeugnis zwar vom gleichen Gott liefern wie die süddt. Od-Orte, aber doch auch von der andersgearteten Lauttradition.
Ottenstein ist ein Stadtteil von Ahaus im Westmünsterland. Die vorausgehende Burg ist 1316 unter dem Edelherren „Otto von Ahaus“ im Sumpfgelände errichtet worden. Sie ging als Morgengabe 1325 bei Heirat seiner Tochter an den „Grafen von Solms“ über. Der Flecken Ottenstein mit seinen Ortsteilen Lichtenhagen und Glesse liegt auf einer wildromantischen Hochebene über der Weser. Einige Meilen südlich ist der Osterberg. Eine verschwundene Burg Ottenstein stand am heutigen Schlossplatz zu Wittlich in Rheinland-Pfalz. Sie war 300 Jahre lang Aufenthaltsort der Trierer Kurfürsten. Auch steht eine Burg Ottenstein auf einer Anhöhe im Waldviertel Niederösterreichs. Ein Burgherr „Hugo de Ottenstaine“ wurde 1177 erstmals urkundlich erwähnt.
Zurück in den Norden: Die 153 km lange Osteist der längste westliche Nebenfluss der Unterelbe. An ihr liegt die Gemeinde Osten. Auch der Ort Freyersen, dessen Name an den germ. Fruchtbarkeitsgott Frey / Frô erinnert. Ebenso liegt an ihr die Gemeinde Godenstedt (Lkr. Rotenburg). Es gibt ein Estorf an der Oste. Die Gemeinde Estorfan der Weser wurde am 9.2.1096 in einer Urkunde als „Aesdorpe“ erwähnt. „Gräfin Meresvid von Stumpenhausen“ schenkte es der Mindener Kirche. Ausgrabungsfunde erweisen, dass um das Jahr 550 die Ortslage ständig bewohnt wurde. Westlich der Ostemündung liegt Otterndorf mit dem Ortsteil Assel. Otterndorf war der Hauptort des Landes Hadeln, 1261 hieß es Otterentorpe; der Name kann von dem Wassermarder Otter nicht abgeleitet sein, weil diese Tiere unmittelbar am Nordseeküstensaum kein Vorkommen hatten. Ostendorf gehört zu Bremervörde und hat den Ortsteil Ottendorf. Etwas südlich von Tostedt gibt es ein Otter. Otterstedt und Ottersberg sind östlich von Bremen. Oederquart, zwischen Oste und Elbe, besitzt eine historisch bedeutsame Thing-Stätte. Ostereistedt liegt genau auf der Wasserscheide zwischen Elbe und Weser. Otter (urkundlich 1319 Otter, 1497 Otther) liegt südlich von Hamburg im äußersten Nordwesten der Lüneburger Heide, östlich des 101 m hohen Otterbergs. Südlich von Bremen liegt Asendorf (Lkr. Diepholz), das um 1250 eine Pfarrkirche („parochia in Asenthorpe“) besaß und schließlich auch ein Kloster. Assel liegt nördlich von Stade an der Elbe. Asselburg (auch Burg Assel, Asleburch, Asleburgoder Hesleburg) war eine Burg westlich von Hohenassel, heute ein Ortsteil von Burgdorf (Lkr. Wolfenbüttel), südlich von Braunschweig. Ein Asendorf ist Ortsteil der Gemeinde Kalletal zwischen dem Lipper Bergland und dem Teutoburger Wald und Weser. Ein weiteres Asseln ist ein östlicher Vorort von Dortmund im Osten des Ruhrgebiets. Hier stieß man auf bronzezeitliche Grabanlagen von um etwa 1000 v.0. Damals verbrannte man die Toten, über die Aschenurne wurde ein kuppelförmiger Erdhügel aufgeschüttet. Um ein Abfließen der Erde zu verhindern, wurden die Hügel oder einem Kreisgraben eingefasst. Diese Ablagen hatten zumeist einen Durchmesser von zehn bis zwölf Metern, die Asselner Gräber erreichen dagegen einen Durchmesser bis zu 17 Metern. Noch in der Völkerwanderung waren hiesige Gräber reicher als üblich ausgestattet. Eine urkundliche Erwähnung fand um 882 in einem Güterverzeichnis des Klosters Werden als „Ascloon“, was als Eschenwald aus einem ursprünglichen „Assloh“ (Asenwald) von den Mönchen umgeformt sein dürfte. Die gleiche Urkunde erwähnt den ersten namentlich bekannten Asselner: Er hieß Alfdag, er war ein erdrückend besteuerter Abhängiger vom Kloster. Alfdag ist ein Name aus altgläubiger Asenreligion (Alfen = Seelengeister).
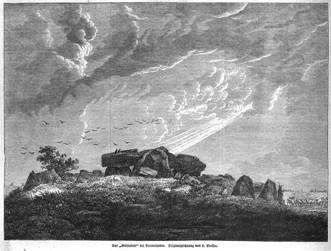
Der altsächsische Gau Haduloha, zwischen der Mündung der Elbe und der Weser, stellt das ursprüngliche Kerngebiet der Sachsen dar. Sievern, im Landkreis Cuxhaven, war ein Machtzentrum in alter Zeit, von dem die„Pips- “ oder „Pipinsburg“,am Nordufer der „Sievener Aue“, Zeugnis gibt. Der Begriff kommt von dem niederdeutschen und verwandten engl. Begriff „to peep“ für ausspähen, auslugen und aufpassen. Die nahe „Heidenschanze“ hat man auch „Karlsburg“ genannt, sie stammt aus der Zeit zwischen 50 v.0 und dem 1 . Jh. n.0. Mehr als zehntausend Denkmale und Fundstellen sind bekannt, die die Anwesenheit des Menschen und seiner Ansiedlungen seit der Altsteinzeit bezeugen. Von ihnen hat sich bis heute eine bemerkenswerte Zahl erhalten. Auch die „Heidenstadt“ ist eine Ringwallanlage, die eine stattliche Größe von ehemals 220 m x 180 m im Durchmesser aufweist. Sehenswert ist ebenso das sog. „Bülzenbett“, ein zwischen 3.500 und 2.800 v.0 errichtetes Großsteingrab der Trichterbecherkultur, der ältesten bäuerlichen Kultur im norddeutschen Flachland. Der gewaltige Deckstein ruhte auf neun Tragsteinen. (Abb. Bülzenbett, Grafik von L. Preller, 1866
Im Rückzugsgebiet des Harzes, einem der germanischen Kernländer, blieb der Glaube an die alten Götter im Volk noch lange nach dem christenkirchlichen Umbruch in lebendiger Erinnerung. Davon zeugen auch die vielen Harzsagen, die von Teufeln handeln, zu denen die Kirche die einstigen Volksgötter verunholdet hatte. Von den bizarren Felsrippen der „Teufelsmauer“ im Harzer Naturpark zwischen Ballenstadt und Blankenburg geht folgende kirchlich gefärbte Sage: „Als die Karolinger damit begannen, die einheimischen heidnischen Sachsen zum Christentum zu bekehren, entstanden im nördlichen Harzvorland auch zahlreiche Kirchen, Kapellen und Klöster. Der Teufel sah dies mit wachsendem Unbehagen und begann, sein Reich mit einer Mauer gegen die Ausbreitung des Glaubens an den christlichen Gott zu schützen. Doch was er nachts aufbauen konnte, stürzte ihm am Tage wieder ein. Schließlich gab der Teufel auf, weil er einsah, dass er die Verbreitung des Christentums nicht aufhalten würde. Lediglich einige Reste seiner Mauer überlebten die Zeit.“ Da der Teufel von den Klerikern ausführlich in seiner angedichteten Bocksgestalt ausgemalt wurde, aufgrund der griech.-röm. Mythentradition des wollüstigen, bocksbeinigen und ziegenköpfigen Hirtengottes Pan, ist es naheliegend und folgerichtig, die vielen Bocksberge in Deutschland als Teufelsberge zu deuten. Denn an den auffälligen Höhen einer jeden Region machten sich auch schon im Altertum die altgläubig-sagenhaften Vorstellungen von Göttinnen und Göttern fest. Auch bei Hahnenklee, einem Ortsteil von Goslar, gibt es den Bocksberg und die Bockswiese. Die Ausdrücke vom rohen, starren „Block“ und „Klotz“ spielten im gebranndmarkten Hexenwesen eine ersichtliche Rolle, so kam es zu der Bezeichnung der heidnischen Blocksberge. Sie gelten in einigen Sagen als Versammlungsorte finsterer Wesen und als Tanzplätze der Hexen, die dort in der Walpurgisnacht oder auch zu anderen Zeiten des Jahres mit dem Teufel sinnliche Feste feiern würden. Eine Erwähnung des Namens „Blokkesberghe“ führt uns ein Lübecker Gebetbuch von 1485 vor, dann 1668 die Schrift des Johann Praetorius „Blockes-Berges Verrichtung“. Im Besonderen der Brocken, südöstlich von Goslar, wird mit dem „Hexenunwesen“ in Verbindung gebracht. Sicherlich wird es auf den heimlichen Bergeskuppen manche Versammlungen der ausgegrenzten und gehetzten Heiden gegeben haben, doch späterhin wurden sie einfach zu Festplätzen freiheitsdurstiger, fröhlicher Menschen. Walpurgistanzfeste auf den markanten Bergeshöhen veranstaltete die Jugend bis in die Neuzeit hinein, trotz fortwährender Verbote der Obrigkeit. So der Brocken (mhd. Brochilsberg) im Harz, Blocks-, Bocks- oder Hexenberge in verschiedenen Gegenden, Bönningsberg bei Loccum, Weckingstein bei Minden, Kiesberg bei Elberfeld in Nordrhein-Westfalen, Bechtelsberg in Nordhessen, Hörselberg und Inselsberg (1250 Enzenberc) in Thüringen, Petersberg (eigentl. Lauterberg) nahe Halle an der Saale, Staffelstein und Walberla bei Bamberg, Kreidenberg bei Würzburg, im Schlochtauer Kreise, der Hupella in den Vogesen, Fellerberg bei Trier, der Kandel im Breisgau, Büchelberg im Elsass, Staffelbergin der Fränkischen Alp, Heuberg im Schwarzwald, Petersberg im Altvatergebirge, Wonne- und Freudenberg in Mähren, jener Hügel unfern Probethen im Samland, der bei Pogdanzig (Ostpreußen), die Brattelenmatte in der deutschen Schweiz, in Schweden der Jungfrukullen und Blakulla (Heckefjell), der heilige Keltenberg „Puy de Dome“ in Frankreich. All diese Stätten luden über Jahrhunderte zum uralten Brauchtum aus dem Altglauben.
Am Südrand des Harzes liegt der Ort Questenberg, von einem Bergsporn mit der Ruine der Questenburg überragt. Mehrere Wallburgen aus der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit auf den nahen Höhen sprechen von der siedlungsintensiven Bedeutung dieses Raumes. Ein Nachklang des altheidnischen Festes zur Sommersonnenwende ist das jährlich am Pfingstwochenende auf dem westlich des Dorfes gelegenen Questenberg gefeierte Questenfest, bei dem zum Sonnenaufgang der Kranz der Queste aus Birken- und Buchengrün mit zwei Quasten von einem mehrere Meter hohen Eichenstamm abgenommen und zur Nachmittagszeit mit frischem Grün beschmückt wieder heraufgezogen wird. Es handelt sich dabei um den germ. Brauch der geschmückten und vom frohen Volk umtanzten Stangenaufrichtung einer sinnbildlichen Weltstütze „Irminsul“ (Säule der himmelserhaltenden Gottheit) zur Sonnenhöchststandsphase, die im deutschen Maibaum und schwedischen Mittsommerbaum lebendig blieb. Nicht weit östlich liegt Hainrode, 1349 Heygenrode genannt, ein Name der auf die Rodung eines heiligen Haines hindeutet. Interessant, die Möglichkeiten der Lautverschiebungen, so wurde das Dorf Heyerodeim Unstrut-Hainich-Kreis 1363 erstmals als Hoiginrade genannt, 1363 als Heigenrade. Eines der ältesten Dörfer in der Region des thüringischen Lkr. Eichsfeld, ist Heuthen (724 u. 950 Heiten), das ursprünglich von dem hier wirkenden, eifernden Papstagenten Bonifaz(ius) persönlich als „Dorf der Heiden“ benannt worden sein könnte. Liegt es doch nahe dem im 9. Jh. schon erwähnten Dingelstädt, einer germ. Thing- und Gerichtsstätte. Auffälligerweise wurde dort sehr früh ein Erzpriestersitz mit der „Kirche des St. Martin“ als Missionszentrum errichtet. Südlich von Questenberg erhebt sich das Kyffhäusergebirge (473,6 m). Auf dem nordöstlichen Bergvorsprung steht die staufische Reichsburg Kyffhausen, die ab 1890 zu Ehren Kaiser Wilhelm I. in Gestalt des „Barbarossadenkmals“ erweitert wurde. Die alte Sage, die zum Bau einlud, bezieht sich zwar auf „Kaiser Rotbart“, doch auch hier muss sie gewoben sein aus einem altgläubigen Mythos vom Seelenberg und dem darin hausenden Od-Gott Wodan. Aus der Zeit um 1400 sind Dichtungen bekannt, deren gleiche Grundhoffnung dahingeht, der verschwundene Kaiser Friedrich würde wiederkehren. Von dem Zurückkommenden erwartete man die Reichseinigung mit Niederwerfung des überhand nehmenden Pfaffentums. Denn das kraftvoll zentral gelenkte Reich des Staufers Friedrich I. und die das reichsfeindliche römische Papsttum in Schach haltende Fähigkeit Friedrich II. blieben dem Volk in sehnsüchtiger Erinnerung. Der kirchlicherseits als Ketzer verunglimpfte Friedrichs II. stand als Inspirator im 14. Jahrhundert auch mit einer geheimen, antiklerikalen religiösen Sekte in Verbindung. Sie hatte im nördlichen Thüringen sowie dem Südharz zahlreiche Anhänger, die mit Feuer und Schwert verfolgt und ausgerottet wurden, nicht anders wie das Altheidentum und die Katharer des 12. bis 14. Jhs. im Süden Frankreichs. Im Jahre 1369 ließ der Dominikaner Walter Kerlinger, ein von Papst Urban V. berufener Inquisitor, in ganz Thüringen Begarden und Beginen sowie die sog. ketzerischen „Brüder des freien Geistes“ ergreifen und zahlreiche umbringen. Allein in Erfurt lebten um 1368 zu Beginn der Verfolgung ca. 400 dieser Menschen, die ein von der Kirche befreites Leben anstrebten. Wer keine Buße tat und nicht „zu Kreuze kroch“, musste wegen des päpstlichen Bannes die Stadt verlassen, wurde verurteilt und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Allein für Thüringen lassen sich noch zwischen 1526 und 1731 über 1.500 Hexenprozesse nachweisen, von denen etwa 75 Prozent mit dem Feuertod endeten. So ist es nicht verwunderlich, dass sich sie unauslöschliche Sage im Volk erhielt, von einem gerechten, starken Friedensherrn, welche nur im Berge schlafen aber eines glücklichen Tages erwachen und auf seinen Thron zurückfinden würde. Die Barbarossasage im Wortlaut: „Der alte Kaiser ist durch einen Zauber, eine übernatürliche heimliche Gewalt, in ein unterirdisches Schloss des Kyffhäuserberges in Thüringen versetzt worden. Hier sitzt er schlafend auf einem Stuhl von Elfenbein und stützt sein Haupt auf einen Marmortisch. Sein roter Bart, bei Lebzeiten dem gelben Flachse ähnlich, leuchtet wie Glut des Feuers und ist durch den Tisch, ja fast um denselben herumgewachsen. Zuweilen bewegt der Kaiser das blonde Haupt, hebt die schweren Augenlider halb und zwinkt oder blinzelt mit den Augen. Durch solch’ traumhaftes Augenzwinkern winkt er in langen Zeiträumen - von 100 Jahren - einem Zwerg, kaum der Größe eines Knaben, hinaufzugehen und nachzusehen, ob die Raben, die Bilder der Zwietracht und des Unglücks, noch um den Berg fliegen und krächzen. Ist dies der Fall, so schließt der Kaiser seufzend die Augen, schläft und träumt abermals 100 Jahre. Erst, wenn der Bart ganz um den runden Marmortisch gewachsen ist und ein mächtiger Adler in stolzem Flug sich aufschwingt, den Berg umkreist und den Rabenschwarm verscheucht, erst dann wird der Kaiser mit seinen gleichfalls verzauberten Getreuen erwachen.”
„Ottstedt am Berge“ ist eine Gemeinde von Grammetal in Thüringen (Lkr. Weimarer Land). Entlang des sog. „Gottesgrabens“ am westlichen Hang des Ettersberges zwischen Ottstedt und dem Gipfel des Berges wurden etliche Funde aus der Jungsteinzeit gemacht. Die erste urkundliche Erwähnung als Odestat (später Odenstat, Odenstet und Utstete) stammt 876 aus dem „Ingelsheimer Protokoll“, wegen deren Einnahmestreites zwischen Kloster Fulda und dem Erzbischof von Mainz. Kaiser Ludwig gewährte schließlich den Fuldaern den Zehnten unter anderem auch an Odestat. Als sich im Jahre 2001 die Ersterwähnung Ottstedts zum 1125. Mal jährte, wurde erstmals eine Chronik vorgelegt, in der es bezüglich des Ortsnamens in der heute induziert wissensarmen aber verzeihlichen Naivität heißt: „Od war ein alter, erfahrener Mann, ein Sippenältester, der sich mit seiner Sippe hier sesshaft gemacht hatte.“ Das gleichnamige Ottstedt bei Magdala ist ein Ortsteil der Stadt Magdala, dessen erste urkundliche Erwähnung als Uthestete am 28.11.1285 erfolgte und1437 als Otstete im Kirchenbuch von Magdala Erwähnung fand. Es heißt offiziell, der Ortsname würde auf die „Siedlung des Ot(i)“ hinweisen. Auch Udestedt (Lkr. Sömmerda) liegt auf uraltem Siedlungsboden schon der Schnurkeramiker im 3. Jt. v.0, über die Bronzezeit bis zur germ. Epoche, in der eine Siedlung östlich um den Tafelberg bestand. Auch dieser altgläubig-wodanische Kultort wurde 876 urkundlich als Odestat im zehntpflichtigen Besitz des Kloster Fulda verzeichnet. Positiv beachtlich ist, dass es hier korrekt heißt: „Der Name des Ortes Udestedt leitet sich ab von einer an der Gramme [Nebenfluss der Unstrut] gelegenen germanischen Kultstätte ,Odinstatt’."

Die ganze Not einer über Jahrhunderte zunehmend entrechteten und gequälten Bauern- und Bürgerschaft brach auf als ein biederer Mann hintrat und vor Kaiser und Kirchenfürsten bekannte: „Gott helfe mir, ich kann nicht anders !“ Martin Luther, aus der thüringischen Wiege Germaniens, wurde der theologische Urheber der sog. „Reformation“, die der deutsche Aufschrei gegen Heuchelei und Ausbeutung durch die Romkirche war. Nach dem befreienden Wort ging es wie ein Lauffeuer durch das Reich, ein Aufatmen, ein Gefühl der Beflügelung ohnegleichen, auf das man seit Menschengedenken gewartet hatte. Am Martinstag, dem 11. November 1483 wurde er auf den Namen des Tagesheiligen getauft. Welch ein Omen -, verstand das Volk den geheiligten Reitersoldaten Martin, dessen Begriff aus dem röm. Himmels- und Kriegsgott Mars abgeleitet ist, doch als eine Inkarnation des Wodan. Sein Tag liegt in der Jahresphase vom altheidnischen „Asa-Alfa-Blod“, dem herbstlichen Opferfest zu Ehren der Ahnen bzw. der Seelengeister. Trotz der Bannbulle des Papstes im gesamten Reich, Luther zu unterstützen oder zu beherbergen, seine Schriften zu lesen oder zu drucken, ihn zu fangen oder zu töten, bekam er Zuspruch aus allen unteren Ständen. Der Maler Albrecht Dürer, fragte sich besorgt in seinem Tagebuch: „Lebt er noch oder haben sie ihn gemordet ?“ Jeder hätte ihn töten können, ohne dafür belangt zu werden. Doch der sächsische Kurfürst „Friedrich der Weise“ schützte den Verfolgten und ließ ihn unter dem Tarnnamen „Junker Jörg“ auf der Eisenacher Wartburg (siehe Abb.) seine Übersetzung der sog. „Heiligen Schrift“ ins Deutsche vollziehen. Seine kirchenkritischen Hauptschriften machten Luther im ganzen Reich bekannt. Es erschienen aus seiner Feder: 1529 „Heerpredigt wider die Türken“, 1543 „Von den Jüden und jren Lügen“, 1545 „Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet“. Die Massen standen auf, Kirchenherren wurden davon gejagt, Klöster in Asche gelegt, die Bauern schrien nach geistiger wie nach Freiheit vom Joch der Leibeigenschaft, die bis dahin biblisch begründet wurde. Doch nach den Massakern an über 5.000 aufständischen Bauern bei Frankenhausen verlor die „Reformation“ ihren Urzug als Volksbewegung und wurde zur Angelegenheit der Landesfürsten, die aus der Niederschlagung der Bauern gestärkt hervorgingen. So kam es zu keiner echten Befreiung, sondern nur zur kleinen Lösung in Form einer Kirchenspaltung bei der lediglich ein Teil Europas dem römisch-katholischen Joch entrann.
Im Jahre 1080 wird die Wartburg das erste Mal textlich erwähnt, durch einen Kleriker des Erzbischofs „Werner von Magdeburg“. Nach anderer Auffassung soll es Bruno, „Bischof von Merseburg“, gewesen sein. Er beschreibt in seinem Werk „De bello Saxonico“ das Heerlager König Heinrich IV. am Fuße „einer Burg Namens Wartberg“. Unter einer Warteverstanden die Altdeutschen einen Beobachtungsposten, einen Wartturm, einen erhöhten Ort von dem man sichernde Ausschau hält. Von den Verben „warten“ über „wahren“ bis „warnen“ umfasst der Begriff das ganze Spektrum einer verantwortungsvollen Landwehr. So ist die Wartburg auch im übertragenen Sinne ein warnendes Mahnmal gegen fremdgeistigen Besitzanspruch und Unterjochungswillen. Im Wartburgkreis liegt das Dorf Wutha, das erstmalig 1349 genannt wurde, obwohl es am„Königsweg“, einer alten Reichsstraße liegt. Die am „Wutinger Feld“ befindlichen Bauernhöfe gehörten zum Grundbesitz Eisenacher Klöster. Man meint, der hiesige Unterlauf des Elbstroms wäre als „Wutaha“, mit der Bedeutung „wilder oder wütender Bach“, bezeichnet worden, doch auch diese Gemarkung könnte den Begriff des Wodan weitergetragen haben. Nicht weit entfernt ziehen sich die „Hörselberge“ (484,2 m), ein Höhenzug bei Eisenach. Siegalten seit Urzeiten als Wohnort der Götter. Der durch mehrere Volkssagen belegte Frau-Holle-Kult ist mit dem „Hörselloch“ eng verbunden. Der geniale Komponist und Dichter Richard Wagner wurde an der Venusgrotte zu seinem Musikdrama „Tannhäuser“ inspiriert. Wir hören im Weiteren mehr davon. Das nicht ferne Gotha wurde erstmals in einer am 25.10.775 ausgestellten Urkunde erwähnt. Mit ihr übereignete „Karl der Große“ dem Kloster Hersfeld unter anderem den Zehnt von den Ländereien, Wald und Wiesen der „Villa Gothaha“. Eine nachweislich im 16. Jh. bekannte Sage „Die Goten als Stadtgründer“ bezeichnet die Stadt als Gründung und Namensträger des Gotenvolkes. Um 510 soll eine Gesandtschaft des Ostgotenkönigs „Theoderich der Große“ nach Thüringen gelangt sein, als dessen Nichte Amalaberga den König der Thüringer Herminafried heiratete. Jene Ostgoten sollen sich unterhalb des heutigen Schlossberges niedergelassen und ihrer Siedlung den Namen Gota gegeben haben. Das wäre durchaus denkbar, doch wissen wir, wie freizügig die Renaissance fähig war, solcher Legendenerfindungen zur eigenen Erhöhung und Ausschmückung. Man wusste damals nicht, dass ein Gothaha aus einer älteren Lautung Wothaha möglich ist.
Hier im Herzen Deutschlands, im alten Thüringen, scheint ein Zentrum des Mutterkultes erkennbar. Zu Beginn des 6. Jhs. erstreckte sich das thüringische Königreich unter König Birsin von Magdeburg im Norden bis nach Passau im Süden, von der mittleren Elbe im Osten bis zum unteren Maingebiet im Westen. Neuere Grabungen stellten fest, dass Magdeburg mindestens 300 Jahre älter ist als seine erste urkundliche Erwähnung im Jahre 805, als es Magadoburg genannt wurde. Als 531 das Thüringerreich unterging, erfolgte die sächsische Besetzung des Raumes, unter der Bezeichnung Ostfalen. Magdeburg (niederd. Meideborg) liegt an einer Furt der mittleren Elbe. „Heinrich I. der Vogler“ befestigte 919 die Stadt gegen die Ungarn- und Slaweneinfälle. Kaiserpfalz wurde sie unter Kaiser Otto I.. Der Stadtname spricht für eine urmutterkultische Tendenz der uransässigen Bevölkerung. Bad Berka (Lkr. Weimarer Land) an der Ilm ist eine thüringische Stadt die berühmt wegen ihrer Heilquellen ist. Ihr Name soll soviel wie „Stadt der Birken am Wasser“ heißen. Ihre Ersterwähnung datiert auf den Mai 1119 als Bercha. Spätere Schreibweisen waren: Birka, Berkaw, Berkau. Anlass der Beurkundung war die Übergabe der Kirche an das Marienstift zu Erfurt. Um 1240 gegründete man am Ort ein Nonnenkloster. Auch hier gab es Hexenverfolgungen; 1673 wurde „Die alte Glasern“ in einem dieser Schandprozesse auf dem „Breslingsberg“ bei lebendigem Leibe verbrannt. Mehrere Anhaltspunkte lassen stark vermuten, dass Bercha ein Mutterkultort der germ. Göttin Bechta / Berchta war, denn die dortigen Heilquellen sprudelten lange vor dem Auftauchen des Christenglaubens und auch der Kultname der Birke, der Birkengöttin bezeigte die germ. Muttergöttin als die weißhäutige Magna Mater. Nach Ausweis altnordischer Textquellen galt der Birkenbaum als Kennwort für die Göttin Freyja / Freija weshalb später auch die kirchliche „Gottesmutter Maria“ in Liedern als Birke gelobt wurde. In Folge dieses Herkommens benannte schließlich ein nordischer Anonymus seine ihm lobenswert erscheinende, schon nicht mehr heidnische Muttergöttin: „hervorragende Birke des Goldschmuckes“. Es gibt ein „Berka an der Wipper“ und ein niedersächsisches Berka am Südharz als Ortsteil der Großgemeinde Katlenburg-Lindau. Die Bedeutung des letzteren geht daraus hervor, dass seine Kirche Sitz eines Erzpriesters im Archidiakonat Nörten war, dem mehr als 50 Kirchen unterstanden. Diese frühe Missionskirche wurde in einem Güterregister des Klosters Corvey, den „Corveyischen Traditionen“ von 890-900 als ein Ort „Berga im Gau Hrittiga“ erwähnt. Unweit von „Berka an der Werra“ liegt Herda, ein Ortsname der ebenfalls von der Muttergöttin abgeleitet sein könnte. Die germ. Göttin Nerth(us) erwähnt Tacitus („Germania“ Kap 40) als „Terra Mater“ (Erdmutter). Einen Hertha-See gibt es auf der Halbinsel Jasmund, zur Insel Rügen gehörend. Um ihn rankt sich die hier frei erzählte Sage, deren Grundzüge mit dem Tacitus-Bericht übereinstimmt: „Auf Rügen lebte nach germanischem Glauben die Göttin Hertha. Ein geheiligter Buchenwald, Stubbenitz genannt, umgab einen tiefen See. In den Wäldern rundum, standen ihre Wagen mit den Gewändern der Göttin bedeckt. Mit denen fuhr sie jährlich im Geleite eines einzigen Heilwarts viermal um ihr Gaue. Heilige Kühe zogen das Gefährt der Göttin der Erde, und wohin dasselbe kam, war Freude und Fülle, Glück und Zufriedenheit. Wenn sie an einem Orte verweilte, bat sie nach einiger Zeit den Begleiter, dass er sie heimwärts führen möge. Stets tat er, was die Göttin von ihm forderte. Zurückgekehrt, wurde in dem See ihr Wagen, Gewand und ihr Bildnis gereinigt, alle Sklaven aber, die sie dabei bedienten, von ihr im See geopfert, damit keiner sie jemals verraten möge. Wie das Christentum Einzug auf Rügen hielt, ist die Göttin nie mehr gesehen worden. Der See aber liegt noch heute düster und abgeschlossen. Wenn seine Wellen erzählen könnten, würden sie sicher sagen, wo der Wagen und die Gewänder, vielleicht auch ihr Bildnis verborgen liegen.“ Auch eine Herthaburg gibt es, in Gestalt einer mittelalterlichen Wallanlage, wo die Göttin ihren Wohnsitz bzw. ihren Tempel gehabt habe. Gedenken wir an der Stelle nochmals des „Hohen Meißners“ mit seinem „Hollenteich“, um den sich auch die Göttinnenlegenden ranken. Vom Meeresgestade bis auf die Bergzinnen im Süden der weiten Germanica und Gallica reichte das altgläubige Herrschaftsgebiet der Mutter und der Mütter. Berchtesgaden wäre als „Garten der Perchta“ zu erklären; erstmals urkundlich erwähnt wurde die Siedlung im Jahre 1102 als Berthersgaden, später als Bertholdsgaden. „Frau Perchta“ist eine mutterreligiöse Sagengestalt, deren Begriff sich ableitet von ahd. „peraht“ = hell / glänzend und demnach „Die Glänzende“ heißt. Wir sind wieder in Thüringen beim Ortsteil Herda von Berka. Die dortige Kirche ist der „hl. Margarethe“ geweiht. Südlich davon liegt das erstmalig 1202 urkundlich erwähnte Nonnen- bzw. Marienkloster „Frauensee“. Von dieser Frühzeit berichtet die feine Novelle „St. Conventus in lacu“ (Heilige Zusammenkunft am See). Zwischen dem genannten südwestlich von Eisenach liegenden Berka, das schon vor 900 als Berchaho / Berhohes in den Urkunden bezeichnet wurde, und „Berka v. d. Hainich“, nördl. von Eisenach, zieht sich der Kalkrücken mit den Hörselbergen und der mutterkultischen Venushöhle im „Großen Hörselberg“, um den sich entsprechende Sagen und Märchen ranken. Ein Heimatforscher beschrieb die mythische Grotte recht nüchtern als eine „viereckige Felsspalte“ von einem Meter Höhe und etwa einem halben Meter Breite, die kriechend passiert werden müsse und in einen übermannshohen Gang führe, der knapp 20 Personen Platz böte. Das Loch sei fürchterlich ungastlich wegen seines glitschig-abschüssigen Inneren und der Myriaden von Mücken, die sich ausgerechnet dort versammelt hätten. Der mütterliche Berg birgt, verbirgt und bringt aus seiner Heiligkeit das Geborgene auch wieder hervor. Hier ist die Frau Holle / Holda zu Hause und Tannhäuser wurde von der Venus verführt. Heinrich Kornmann beschrieb ihn 1614: „Mons Veneris, Fraw Veneris Berg, das ist, wunderbare und eigentliche Beschreibung der alten haydnischen und newen scribenten Meynung, von der Göttin Venere...“ Bei ihm heißt es weiter, ins Hochdeutsche übertragen: „An der östlichen Seite des Berges strahlten dem Erkorenen, der den Eingang finden konnte, die goldenen Worte von einer azurblauen Marmortafel entgegen: ,Hier hält Frau Venus Hof !’ Besonders wurden durch ihre Fahrten zu Venus die Ritter Adelbert, Schasenheim und der edle Tannhäuser, die dieses Abenteuer bestanden, berühmt. Es wurde geritten, gerannt, gejagt, geschmaust, gezecht, getanzt, gelebt und geliebt...". „Der sitzt im Venusberg“, bedeutete sprichwörtlich: Der lebt hoch, in allen üppigen Lustbarkeiten des Lebens und des Liebens. Die altgerm. Göttin Nerta / Holda / Berta / Bercha / Perchta / Fru Gode - die mit 7. sowie 11. „ODiNG-FUÞARK“-Rune versinnbildlicht wurde - die freundliche, milde, gnädige - deren jährlicher Umzug durch das Land den Fluren Gedeihen und Fruchtbarkeit brachte, musste mit dem Eindringen des Christentums das Schicksal aller übrigen Götter teilen, deren Dasein und Wunderkräfte zwar nicht gänzlich bestritten, doch da der Glaube an ihre früheren segenreichen Einwirkungen zu tief im Volke wurzelte, bösartig verdächtigt, umgebildet und verketzert wurden.
Thörey (Lkr. Ilm) ist ein Ort im „Thüringer Becken“, genauer im Städtedreieck Erfurt - Gotha - Arnstadt. Ersterwähnung erfolgte 948 als Dorehug („Hügel des Donar-Thor“ ?), in einer Zeit die noch deutlich heidnisch geprägt war, so dass der Name des kämpferischen germ. Wetter- und Hammergottes nicht ganz anachronistisch erscheinen muss. Später wurde daraus Thoronua, ab etwa 1850 Thörey. Allerdings wäre zu bedenken, dass die Ableitungserklärungen des Begriffes „Thüringer“ so schwanken wie die alten Schreibweisen. Entstanden sie aus den Turonen oder Hermunduren ? Um 400 sind sie als Toringi belegt,aber die Namensformen T(h)ueringi / Thoringi / Thuringigestatten auch Vermutungen, sie aus den gotischen Terwingen / Teruingi zu erklären. Diese Theorie könnte gestützt werden durch die Existenz des nahen Gotha. Auch die Ansiedlung Gottstedt (1104 Gotenstete, später Gothinstete, Godtstedt oder Gottinstedte), zwischen Gotha und Erfurts, spräche möglicherweise dafür. Es könnte sich bei der alten Ortschaft Dorehug um eine heilige Höhe der Thüringer gehandelt haben. Die Dorfkirche von Thöry, deren Turm aus früher romanischer Bauphase erhalten blieb, errichtete man von 1100 bis 1174, sie ist „St. Wenzel“ geweiht. Wenzel war ein Sohn des Herzogs Wratislaw I. von Böhmen, der selbst an die Macht gelangte, aber von seinem Bruder umgebracht wurde. Zwar fand er als Nationalheiliger der Sclavania große Bedeutung, doch drang seine Verehrung auch ins westliche Europa hinein. Im 11. Jh. entwickelte sich seine Darstellungen zum ritterlichen Fürsten und zum Schlachtenhelfer mit den Attributen Schild, Schwert, Lanze. Es spräche allerdings dafür, das alte Dorehug für eine altgläubig-kultische Höhe anzusehen, das Vorhandensein der nur ca. 7 km westlich entfernte Mühlburg auf dem Mühlberg, über dem Dorf Mühlberg, die als älteste Burg der „Drei Gleichen“ und das älteste erhaltene Bauwerk Thüringens erkannt ist. Mit Urkunde vom 01.05.704 schenkte der thüringische Herzog Hedan II. das „Castello Mulenberge“ zusammen mit Gütern in „Mulenberge“, Arnestati und Monhora dem „Willibrod von Utrecht“, der sich in der Beeinflussung der Friesen und Thüringer zum Christentum hervortat. Die im Anblick schöne Gesamtheit der drei beieinander stehenden Höhenburgen im thüringischen Grenzraum, „Burg Gleichen“, „Mühlburg“ und „Veste Wachsenburg“, sicherte die alte Kupferstraße. Die Geleitburgen ragen aus der sie umgebenden welligen Landschaft steil empor -, die „Burg Gleichen“, auf einem Kegelberg, um etwa 100 Meter. Als „Gliche“ wurde sie 1034 erstmals erwähnt, ein Begriff (glich = Felsen), der keltisch zu deuten wäre. Im 11. Jh. wurde hier die heutige Ringburg errichtet, welche durch die literarisch und musikalisch verarbeitete Sage ihren hohen Bekanntschaftsgrad erreichte. Der bereits verehelichte „Graf von Gleichen“ soll auf einem Kreuzzug in Gefangenschaft geraten, doch mit Hilfe einer schönen Sultanstochter, unter der Bedingung sie zu heiraten, zur Befreiung und Flucht gelangt sein. Fortan habe er zuhause auf seiner Burg mit zwei Frauen glücklich gelebt. Ob da nicht die lüsterne Sage der „Frau Venus“ vom ca. 25 km nahen Hörselberg Pate gestanden hat ? Dass wir es auch in diesem thüringisch-hessischen Großraum mit einem einstmals ganz intensiv gelebten frommen Heidentum zu tu haben, darf aber als gesichert gelten. Westlich vor Gotha liegt Teutleben, das 819 urkundlich als „Teitilebu“ erscheint, weil eine vermögende Frau Gertrud ein Nonnenkloster gründete, das sie dem Kloster Fulda schenkte, womit sie sich entscheidende Vorteil im christlichen Jenseits versprach. Sie behielt sich den Nießbrauch an den Besitzungen nur bis zum Tode vor. Tuiskon / Tuiston / Teut galt als der mythologische Urvater des germanischen Volkes, der bei den Kelten als Teutates („Touto tati s“ = Vater des Stammes) verehrt wurde. Unter „teut", dialektisch „teit“, konnte in alter Zeit der Gott, aber auch einfach ein deutscher Volksgenosse verstanden werden. Jedenfalls weist der Name auf vorchristliches Gedankengut hin. Ebenso wie einige Namen der unmittelbaren Nachbargemeinden derartig gedeutet werden könnten: Aspach (932 „Asbach“ = Asenbach), Fröttstädt (1267 „Vrutenstete“ = Stätte des Fruchtbarkeitsgottes Frô), Laucha (1039 „Lawcha“, 13. Jh. „Louchaha“ = Ort des Lauchs / Heilkrautes), Mechterstädt (775 „villa Mehderstede“, später Mehtrichesstat = altengl. mæðerianstad = Ehrenstätte), Metebach = Mettenbach; Metten / Parzen = Schicksalsgöttinnen), Trügleben aus mhd. trügenlêre = Irrlehre / Götzenglauben / Heidentum, bei Unterstellungeiner Namensgebung durch die Missionare Bonifaz(ius) oder Willibrod.
Der Erfurter Dom, „Marienkirche“, auch „Propsteikirche Beatae Mariae Virginis“, genannt, ist der älteste Kirchenbau der Stadt und war das gesamte Mittelalter über Sitz des Kollegiatstifts „St. Marien“. Auch hieran ist ablesbar, wie sehr die thüringische Bevölkerung mutterkultisch geprägt war und ihr die schlauen Kleriker mit dem Angebot des Marienkultes entgegen kamen. Um 741 schrieb Bonifaz(ius) an den Papst Zacharias in Rom wegen der Gründung eines Kirchensprengels „an dem Erphesfurt genannten Ort, der schon seit langem eine Siedlung oder Burg [urbs] heidnischer Bauern war“. Nur wenige Jahre später, wohl schon in frühen 750-er Jahren, wohl nachdem Bonifaz(ius) und die Gruppe seiner Mittäter 754 von den Friesen wegen ihres ungebührlichen Betragens erschlagen wurden, löste sich der Sprengel wieder auf. Bonifaz(ius) war ein psychotisch Getriebener, selbst seine eigenen Parteigänger meinten, dass er oft über das Ziel hinausschösse. Überall spähte der Kleinlichkeitskrämer umher, um Abweichler sowie neue „Irrlehren“ zu entdecken und auszuräuchern. Anmaßend und machtbesessen hielt er sich als Legat des Papstes für die höchste Instanz in allen Glaubensfragen nördlich der Alpen. Nur seinen Herren, den jeweiligen Päpsten, denen er die machtvolle Position verdankte, kam er in devoter Unterwürfigkeit entgegen. Für sie, die religiösen Imperialisten, arbeitete er unermüdlich wie ein Besessener an der geistigen Gleichschaltung und Unterjochung aller Nordvölker. Unter die totalitäre Macht Roms wollte er sie beugen. In seinem närrischen Trieb zu reglementieren, Satzungen aufzustellen, Zwänge zu schaffen, das Volk zu knebeln und ihm die Lust zum freien Atmen zu nehme, kam es zu solchen Tollheiten, dass er den Papst mit Anfragen belästigte beispielsweise von der Art, wann der im Rauch hängende Speck gegessen, oder ob die „Pflicht der Fußwaschung“ auch auf die Nonnen ausgedehnt werden dürfe. Seine Frauenfeindlichkeit teilte er mit den anderen krankhaften, lebensfeindlichen Eiferern. Priester mit Familie verfolgte er in unauslöschlichem Hass -, auf sein Betreiben wurde der irische Geistliche Clemens, der seine Frau und Kinder nicht verlassen mochte, in den Bann getan und mit anderen ins Gefängnis geworfen. „Denn in ehelicher Gemeinschaft, so meinte die innerkirchliche romhörige Partei, „kann man nicht beten“. Und da man immerfort und ohne Unterlass beten müsse, solle man nie in der Knechtschaft der Ehe leben, Fleisches leben, denn die Verehelichten seien Knechte des Fleisches, nicht aber Christi und des Geistes. Dieser allerchristlichste Trugschluss brannte das Schandmal der teuflischen Geschlechteslust den Frauen auf die Stirn. Auf den Mann ist der Geist und auf das Weib die Sinnlichkeit verteilt, und diese Polaritäten stoßen einander ab und bekämpfen sich in ewiger Feindschaft, so lautete das unglaublich anmaßende Dogma dieser Männerreligion.
Der in Fleischeslust Gefallene ist allezeit ein verführtes Opfer des Weibes, das den Mann in die Pforten der Hölle stößt. Ja, es schien diesen „heiligen Männern“ nicht einmal sicher, ob die Frau überhaupt als Mensch zu bewerten wäre. Dieser Frage widmeten sich sehr ernsthafte Theologen, namentlich die Bischöfe der fränkischen Provinzsynode in Mâcon (581-83), in tiefschürfenden Beweisanträgen. Eine solche Auffassung von der Ehe bedeutete einen umwälzenden Angriff, ja einen Sturz uns Chaos, für das sittliche Empfinden der Germanen. Bonifaz(ius) war einer von jenen gefühlsarmen, oder durch jahrzehntelange Selbstkasteiung zum kirchenfrommen, seelischen Krüppel verformten gefährlichen Fanatiker. Wer der Frau die Würde der Germanin erhalten wollte, galt als „im Irrtum des Heidentums befangen“, wie Papst Gregor II. an Karl Martell schrieb. Eine völlige Umformung der alten Werte vollzog sich unter dem neuen Vorbild. Treue wurde zu Ungehorsam, Treuebruch wurde zur Tugend. Über den sich fortzeugenden Irrsinn des Bonifaz(ius) teilt noch der Scholastiker „Wenrich aus Trier“ dem Papst VII. mit: „Jenes Gesetz ist von der Hölle ausgespien, die Torheit hat es verbreitet, und der Wahnsinn sucht es zu befestigen.“ Bonifaz(ius) gehörte zu den unholden Geistern, die unserem Volk jene furchtbaren Bürden aufbanden und Wundenaufrissen, die nun seit tausend Jahren schwären. Jene, die dem Papst und seinen Legaten widerstanden, galten als „unvernünftige Tiere…“, die durch die List des Teufels verführt, in Irrtum verfallen“ seien. Wer die Wühlarbeit des Bonifaz(ius) behinderte, wurde mit dem Bann und ewiger Verdammnis bedroht.
Schließlich befand sich sein „durch langes Leben aufgezehrter Körper“ im Endstadium, der natürliche Verfall war absehbar. Von Heidenhand ermordet zu werden, hieß noch aus dem ohnehin bald eintretenden Tod ein Geschäft machen, dafür winkte zum einen reicher Lohn im Himmel, zum anderen ließ sich der Mord an einem christlichen Bischof zum Nutzen der Kirche propagandistisch hervorragend vermarkten. Bonifaz(ius) hieß vor der Abreise nach Friesland, in die Höhle des Löwen, seinen Intimus Lullus, das Leinentuch nicht vergessen, wohinein man seinen edlen Märtyrerleichnam einzuwickeln habe und bezeichnete sogar eine bestimmte Bücherkiste, in welcher seine Leiche heimzutransportieren sei. Es war alles fein säuberlich geplant. Er provozierte in der Hoffnung, die Wut der verhöhnten Friesen herauszufordern. Den Tod seiner jüngeren Gefährten nahm er dabei selbstsüchtig und gnadenlos in Kauf. Bei sachlicher Betrachtung, die sich freihält von christlicher Vernebelung, rundet sich das Charakterbild eines Psychopaten. Bonifaz(ius) fand sein selbstgeplantes Ende, wie die Legende berichtet, im Sommer 754 bei Dokkum - er wurde von Friesen hingemordet, wie es heißt - hingerichtet ist aber sicher die ehrlichere Bezeichnung. Denn wie dieser Mann, samt seinen mehr als 50 Begleitern, dort bei den „Teufelsanbetern“ gehaust haben mag, lässt sich leicht ausmalen. Die ununterbrochene Entweihung der Heiligtümer des Landes war sein „höherer“ Auftrag. Er wird ihn als alterskranker, selbstherrlicher, verbitterter, von Hass gegen Andersdenkende zerfressener Greis, in der von ihm bekannten rücksichtlosen Art und Weise aufgeführt haben. Im Bericht des Bonifatius-Gehilfen Willibald des 8. Jh. hört sich das so an: „Er zog durch das Friesland, tilgte die heidnischen Gebräuche aus, beseitigte den Götzenglauben und zerstörte die falschen Heiligtümer.“ Aus Sicht der Friesen muss er wie ein blindwütiger Tor, ein wutschnaubender Narr, erschienen sein. Kein gesitteter, redlicher Mensch vermochte sich an den Weihestätten, an denen Frieden und Zurückhaltung geboten war, zu vergreifen. Als „Wolf im Heiligtum“ wird er zusammen mit seinen Spießgesellen, mehrheitlich Angelsachsen, ergriffen, verurteilt und nach Recht und Gesetz hingerichtet worden sein. Es wird berichtet, dass der in Deutschland unter fränkischem Staatsschutz einstmals so herrisch-anmaßend auftretende Bonifaz(ius) im zwar selbstgewählten Sterbemoment erbärmlich genug war, gegen den ihn richtenden Schwerthieb intuitiv schutzsuchend sein Brevier über den Kopf hochzureißen.
Bei Westeremden im westfriesischen Küstenland fand sich 1917 beim Abgraben eines Terphügels das runenbeschriftete Eibenstäbchen welches aufgrund der Fundumstände in die 2. Hälfte des 8. Jhs. datiert und als „Westeremden B“ bezeichnet wird. Es liegt verwahrt im niederländ. Museum Groningen. Die Inschrift umfasst zwei Zeilen mit insgesamt 41 Runen, die der altfriesischen Sprache zuzuordnen sind. Einige Zeichen entziehen sich der problemlosen Deutung, weil sie sich sowohl vom üblichen Ur-System, wie vom altengl. und jüngeren unterscheiden. Trotzdem ist die Inschrift mit hoher Wahrscheinlichkeit als so eine Art Verurteilungsurkunde des Bonifaz(ius) zu erkennen, sie lautet: „Auf der Heimstätte erinnerte [man] Unruhestifter [an seine] Missetaten, seine Leute auf Knien schwiegen alle“, in verständlichem Satzgebilde bei Berücksichtigung signifikanter Begriffe: „Auf friesischer Heimstätte wurden dem Unruhestifter seine Missetaten vorgehalten, er und seine verwandten Mittäter lagen alle schweigend auf den Knien.“
Die Aburteilung und Hinrichtung des Bonifaz(ius) führte offensichtlich auch zu den erwartungsgemäß einsetzenden vermehrten Verstimmungen und politischen Spannungen zwischen dem Frankenreich und Friesland, die aggressive Politik der Franken hatten wieder eine Handhabe einen Überfall zu unternehmen. Im tendenziösen Bericht des Priesters Willibald, dessen Kern im Juni 778 aufgezeichnet wurde, heißt es: „Als die Kunde von dem unerwarteten Untergang des heiligen Märtyrers durch die Gaue … flog, scharten sich die Christen unverzüglich zu einem großen Heerzug zusammen und zogen über die Grenzen ihres Gebietes, um Rache für den Tod des heiligen Bekenners zu üben. So brachen sie als unwillkommene Gäste in das Land der Ungläubigen ein und brachten den ihnen entgegen ziehenden Heiden eine schwere Niederlage bei. Die Feinde wandten sich zur Flucht und verloren ihr Leben und ihre ganze Habe. Die Christen raubten ihre Frauen und Kinder wie auch ihre Knechte und Mägde und kehrten in ihr Land zurück.“ (G. Hess, „Amlud oder Ase ? - Die friesische Verurteilungsurkunde des Tempelschänders Bonifatius“, 1999)
Alkersleben (1257 Alkersleibin) ist eine thüringische Gemeinde im Ilm-Kreis an der Senke der Wipfa, östlich von Arnstadt. Ihr Name könnte, wie jener der Gemeinde Alken (Lkr. Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz), die 10. Jh. Alkana hieß, auf das göttliche Brüderpaar der Alken, auch Alcis, zurückzuführen sein. Es liegt bei ihnen ein uralter indogerm. Mythos zugrunde, der von Indien bis Westgermanien nachweisbar ist. Die Alken erscheinen unzweifelhaft bereits in der skandinavischen Bronzezeit in Gestalt von Felsbildern und Bronzefigürchen. Sie waren so wichtig in der germ. Religion, dass der Runenschöpfer ihnen im 10. Buchstaben seines „ODiNG-FUÞARK“- Systems einen Platz einräumte. Der röm. Geschichtsschreiber Tacitus schreibt über sie in seinem Werk „Germania“ (43,3) von ca. 90 n. 0: „Bei den Nahanarvalern [Wandalen in Schlesien] zeigt man einen Hain, eine uralte Kultstätte. Vorsteher ist ein Priester in Frauentracht. Die Gottheiten, so wird berichtet, könnte man nach römischer Auslegung Kastor und Pollux nennen. Ihnen entsprechen sie in ihrem Wesen: sie heißen Alken. Es gibt keine Bildnisse, keine Spur weist auf einen fremden Ursprung des Kultes, gleichwohl verehrt man sie als Brüder, als Jünglinge.“ Es gibt weitere Alken-Orte im Osten vom dänischen Jütland, im belgischen Flandern, wo Alken nach deutsch-limburgischen Dialekt „Alleke“ gesprochen wird, und ein Alken an der Untermosel, das im 10. Jh. als Alkana erstmals Erwähnung fand.
Das im 12. Jh. gegründete Waldhufendorf Oederan, mit der Udohöhe (498 m), liegt im nördlichen Erzgebirge, Mittelsachsen, 45 km westsüdwestlich der Landeshauptstadt Dresden. Die kirchenchristliche Missionsarbeit vermochte hier erst sehr spät Fuß zu fassen. 1286 wurde der Ort urkundlich und 1292 erstmals als Stadt erwähnt. Einer Sage von 1211nach erhielt die Gemeinde ihren Namen nach einem Kaufmann Ranius und einer Grabtafel-Inschrift „Edda Ranio“. Demnach wäre Edda die Frau von Ranio gewesen, die Oederan nach dem Tode des Mannes aufgesucht haben soll und den Grabstein errichten ließ. Deshalb soll sich aus „Edaran“ der Ortsname „Oederan“ geformt haben. Diese Geschichte ist sprachgeschichtlich kaum nachvollziehbar und eher ein Hinweis darauf, wie kreativ auch die dortige Kirche im Mittalalter altheilige Ortsnamen zu vereinnahmen und ins Unverfängliche umzudeuten wusste. Bei Oederan, Öderan, dürfte es sich, wie bei den vielen gleichlautenden Ortsnamen auch, um ein vorchristliches Od-Heiligtum gehandelt haben, welches auf der Udohöhe lokalisiert werden kann. - Unmittelbar südlich der vertriebenen südmährisch-deutschen Gemeinde Muschau (jetzt tschechische Wüstung Mušov) liegt grenznah das niederösterreichische Dorf Ottenthal (Bezirk Mistelbach). Römerzeitliche Befestigungsanlagen in Muschau aus der Zeit der Markomannen-Kriege (166-180 n.0) des Kaisers Marc Aurel wurden festgestellt. 1988 hat man das kaiserzeitliche Kammergrab eines germanischen Würdenträgers entdeckt, das aufgrund seiner fürstlichen Beigaben als „Königsgrab“ bezeichnet wird. Es muss sich um einen markomannischen Gauherren gehandelt haben, der sich mit der röm. Besatzungsmacht arrangierte, um zu überleben. Seine letzte Ruhestätte enthielt prunkvolle antike, provinzialrömische und typisch germanische Gegenständen aus dem 2. und teilweise auch dem 1. Jh. Dazu gehören silberne und vergoldete Gürtelbeschläge, Keramiken, Waffen, verschiedene Kessel, Eimer. Einzigartig ist der Bronzekessel mit Ringgriffen mit vier Germanenbüsten von Männern welche typische Frisuren tragen, die seitlich am rechten Kopf gebundenen sog. „Suebenknoten“. Diese Haartracht scheint sich in der weiten Germania allgemeiner Beliebtheit erfreut zu haben. Besonders gut erhalten ist sie am vollen Schopf des „Mannes von Dätgen“ und des „Mannes von Osterby“ (Krs. Rendburg-Eckernpförde), Moorleichen aus dem 2./4. Jh. Bekannt ist die schöne Bronzefigur eines kniend betenden Germanen mit Suebenknoten („Bibliothèque nationale de France“, Paris). Ebenso zeigt das röm. Siegesdenkmal von Adamklissi (Tropaeum Traiani - Rumänien) von 108/109 n.0, die Abbildung eines germanischen Dakers mit Haarknoten. Auch die Bronzefigur des muskulösen, gefesselten Germanen in der röm. Abteilung der „Museen der Stadt Wien“ trägt ihn, ebenso der Marmorkopf aus dem wallonischen Somzée (Königl. Mus. d. Schön. Künste“, Brüssel), um nur einige derartiger Belegfunde zu nennen. In einer wissenschaftlichen Arbeit über Germanen von Blanka Kratochvilová heißt es: „Haar und Bart galten bei den Germanen als Symbol der Kraft und Ehre des Mannes. Das Abschneiden aller Haare wurde als Zeichen der Buße für eine ehrlose Tat betrachtet und gleichzeitig stellte es ein Opfer an die Gottheit, die durch die Tat beleidigt wurde, dar. Frauen wurden gleichermaßen bestraft. Diese Opfer an die Gottheit hat auch das Christentum übernommen, wo ordinierte Mönche und Nonnen ihre Haare opfern müssen. Deswegen stellte man sich die Götter mit dem reichen gekrausten Haar und mächtigem Bart vor.“

Der Felskegel der Burg Hochosterwitz (siehe Abb.) wurde 860 n.0 als Astarwizza urkundlich erwähnt. Der Begriff wäre möglicherweise zu erklären aus Astrum (lat. Stern, pluralis: Astra) und germ. u. ahd. wizzago, wizago = Weiser / Wahrsager, also als ein Berg der Himmelsbeobachtung. Die Burg liegt im österreichischen Kärntner Land nördlich von Magdalensberg, sie war bis zur Mitte des 12. Jhs. im Besitz des Erzbistums Salzburg. An der nordwestlichen Außenmauer befindet sich die eingemauerte Inschrifttafel eines röm. Reliefs einer Opferdienerin. Vor der röm Okkupation war diese Region das Zentrum des keltischen Reiches Noricum. Am Fuße des Magdalensberges liegt Ort und Schloss Ottmanach / Otmanje, eine der ältesten Besitzungen aus dem 12 Jh. Weiter südlich, Richtung Klagenfurt, ist Schloss Gundersdorf. In der Nähe der Gemeinde Maria Saal liegen die Ortschaft „St. Michael am Zollfeld“ und das benachbarte „St. Donat“, wo sich in der Antike eine röm. Siedlung mit Tempelbezirk befand. In die Außenwände der Kirche sind vorkeltische, keltische und römische Reliefsteine mit Personendarstellungen eingemauert. Im Dorf Wutschein, nahe Poggersdorf, gibt es eine Statue, von der man sagt, es sei die „Isis-Noreia“, die keltische Landesgöttin. Die Sitzstatue wird auch als „Peachta Waba“ bezeichnet, ein Begriff in dem der Kultname der altdeutschen Göttin Bechta / Peratha anklingt. (Die Baba-Jaga ist eine Hexe der slaw. Mythologie, auch erwähnt in der ungarischen Folklore) Manche Frauen pilgern noch heute zu ihr hin, um die Göttin um Kinder oder eine leichte Geburt zu bitten, ihr auch etwas in die Opferschale auf ihrem Schoß zu legen. Auch dieser Göttinnenfigur fehlt das Haupt, da während der christianischen Umwälzung den meisten Statuen des Heidentums durch Kopf-Abschlagen die Wirkkraft genommen werden sollte. Der abgetrennte Kopf soll in den Kellerfundamenten des südöstlich gelegenen Bauernhofes eingemauert worden sein, so dass er nicht wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückgestellt werden konnte. Im Ort Frauenberg bei Leibnitz in der Steiermark befindet sich ein hoch bedeutendes Heiligtum der sog. „Isis-Noreia“, die auf dem gesamten Gebiet des hiesigen alten Keltenlandes und des heutigen Österreichs in Verehrung stand. Der Frauenberg ist einer der großen heiligen Berge der Steiermark. In der keltisch-römischen Zeit wurde diese weibliche Heilsgestalt als Herrin des Schicksals, des Lebensglücks, der Fruchtbarkeit, des Bergsegens und der heilenden Kraft insbesondere des Wassers angesehen. Vom Göttinnentempel sind die Grundmauern bis heute erhalten geblieben, als das älteste freistehende Mauerwerk des Landes. Über ihnen hat man 1731 das eingeschossige Messnerhaus für die etwa 150 m westlich erbaute Marienwallfahrtskirche errichtet.
Der Frauenberge als Heilsorte der Göttinnenverehrung gab und gibt es viele in Germanien. Der „Frauenberg“ / „Unser Frauenberg“ / „Marienberg“ ist ein Berg westlich der Würzburger Altstadt. Ein Frauenberg mit Burgruine ist die zweithöchste eigenständige Erhebung der Lahnberge bei Marburg. Auf dem Frauenbergbei Fulda ließ der Missionar und Abt Sturm(ius) 744 im Auftrag seines Meisters Bonifaz(ius) ein Kloster errichten. Ein weiterer Frauenberg ist ein Bergsporn südwestlich der Kreisstadt Sonderhausen in Thüringen, wo nach lokaler Überlieferung in einem heiligen Hain die Kultstätte der Göttin Jecha war. Eine dort erzählte Sage, erst seit dem 19 Jh. belegt, lautet: „In dem Berge, der ganz hohl ist, befindet sich ein großer See. Über den See spannt sich lieblich blau ein Himmelsbogen, der mit vielen funkelnden Sternen besät ist, die sich im klaren See widerspiegeln. Auf der ruhigen Wasserfläche rudert seit Anbeginn der Welt in ewigen Kreisen ein silberweißer Schwan, der vom Ausfluss des Sternenglanzes lebt und im Schnabel einen goldenen Ring trägt. Als der liebe Gott die Erde schuf, gab er ihm den Ring in den Schnabel, damit er die Welt im Gleichgewicht hielte. Wenn der Schwan den Ring fallen lässt, ist das Ende aller Dinge gekommen und die Welt geht unter.“ Das Märchen erinnert an den nordischen Mythos von den beiden Schwänen, die an der Wurzel des Weltenbaums Yggdrasil, am Brunnen der Schicksalsmutter Urd, ihre ewigen Kreise ziehen (altnord. Urðr = Schicksal). Der Ort Jechaburg am steilen Südhang des Frauenberges wurde am 14.06.1004 urkundlich erwähnt. Andere Namensformen waren: Gigenburg, Jecheburc, Jecheburch, Jechenburgk und Jichenburg. Jecha war der Kultname einer besonders in Thüringen verehrten Göttin der Jagd (germ. jach = schnell). Im Zuge der Verchristlichung hat um 714 der eifrige Bekehrer Bonifaz die Stätte entweiht und die Anwohner zwangsbekehrt. Anstelle der Altreligion trat die Marienkapelle „Unser lieben Frauen“, die vermutlich 878 König Ludwig III. errichten ließ. Hier fanden sich reich ausgestattete fränkische Adelsgräber. Im Jahr 989 gründete der Mainzer Erzbischof Willigis ein Benediktinerkloster, was in seiner Blütezeit als Erzpriestertum elf Dekanate, 1.000 Kirchen, Kapellen und Klöster unter sich hatte. Immer wieder ist zu erkennen, dass es die exponierten altheiligen Plätze waren, die zu christenkirchlichen Missionszentren ausgebaut worden sind.
Ganz im Südwesten des keltisch-germanischen Siedlungsraumes, etwa 40 km südwestlich von Straßburg, erhebt sich in den Mittelvogesen der 763 m hohe Odilienberg / Ottilienberg, den die Römer „Altitona“ nannten, wohl nicht anders als die dortigen Altdeutschen: „Hoenburc“ und „Hohenburg“. Fest steht, dass die ersten Menschen schon 4.200 v.0 auf dem Berg lebten. Er, von dem man eine herrliche Aussicht auf die Vogesen und die Rheinebene hat, gehört offensichtlich zu den seit Urtagen heiligen Bergen. Die gigantische 10 km lange sog. „Heidenmauer“ auf seinem Gipfel, die heute bis zu 3 m in die Höhe ragt und etwa 1,7 m breit ist, fügte sich aus 300.000 Sandsteinblöcke aus umliegenden Steinbrüchen. Über die Altersbestimmung gibt es bislang keine Sicherheit, ob gefundene Holzzapfen aus dem 7./8. Jh. nur von Restaurierungen des Werkes zeugen oder vom Baubeginn, ist völlig offen. Laut einer Sage, soll dem elsässischen Herzogs Eticho eine blinde Tochter namens Odilia geboren worden sein. Sie habe den Besitz Hohenburg geerbt und dort - im Gegensatz zu ihrem konservativenVater, christlich geworden - zwischen 680 und 690 ein Kloster gegründet. Schließlich schuf die Kirche einen Wallfahrtsort der „hl. Odilie“, die irgendein Papst zur Patronin des Elsaß erhob. Das Wasser der Quelle auf dem Odilienberg soll gegen Augenleiden helfen; die Odilie wird somit als sehend machende Lichtbringerin angerufen. Angeblich starb Odilia am 13.12.720, was aber als fromme Legende zu begreifen ist, denn es handelt sich hier um das Datum der mittelalterlichen Wintersonnenwende, mit dem Brauchtum der Luzia, der altgläubigen Lichtbringerin. So wie sie ist die Odilia nichts anderes als eine historisierte Allegorie auf die gallo-germanische „Mütternacht“ (altnord. „modranecht“), in der die vorchristlichen Gläubigen die Geburt des neuen Lichtes bzw. des neuen Jahres erhofften. Die Odilie, als ehemalige heidnische Od-Mutter, ist so falsch oder so richtig wie die irische „hl. Brigit“ („Brigida von Kildare“), die als historische Äbtissin besprochen wird, aber in Wahrheit nur die historisierte irisch-keltische Göttin Brigid, die Tochter der Gottes Dagda, verkörpert. Er, der „Gute Gott“, auch „Dagdæ, Ruadh Rhofessa“ („Der Mächtige / Rothaarige mit dem großen Wissen“), wird in diesen altkeltisch und alamannischen Mischgebieten in einem seiner mythologischen Züge, den Wodankult dergestalt beeinflusst haben, dass dem Od-Gott eine Od-Tochter zuwuchs, die als heidnische Odilia zur Lichtspenderin erhöht wurde. Die sog. Klostergründung der Odilie, so wird mitunter vermutet, könnte eine weithin bekannte „Ur-Universität“ für Frauen gewesen sein, an der weibliche Wissenschaften, Spiritualität und Philosophie eine wunderbare Verbindung eingingen. Und erst spätere klerikale Umdeutungen machten daraus das Werk einer christlichen Äbtissin, ähnlich wie bei der irischen Brigid. Noch weiter im allemannischen gewordenen Süden erhebt sich der Uetliberg oder Üetliberg, literarisch auch Uto genannt, es ist der Hausberg der Großstadt Zürich. Als nördlicher Abschluss der Albis-Bergkette hat er eine Höhe von um 870 Metern über Meer. Auf dieser Höhe bestand schon in der Bronzezeit eine Fluchtburg, in keltischer Zeit ein Oppidum und im Mittelalter krönten ihn und den nahen Albiskamm, insgesamt sechs Burganlagen. Im Jahre 1210 wurde die Uotelenburg erstmals urkundlich als Uotilo oder Uatilo erwähnt, denn der Bayernherzog Odilo (vor 700-748) soll, als Besitzer des Berges, ihm seinen Namen gegeben haben. Daraus wird ersichtlich, dass auch der Züricher Hausberg ein altheiliger Od-Berg ist, dem - wie wir wiederholt erkennen konnten - die kirchenchristlicherseits verfemte Od-Bezeichnung sicherlich nachträglich durch einen unverfänglich erscheinenden Besitzernamen angedichtet worden ist.
Weitere heilige Berge im Südwesten Deutschlands im alten Alemannengau und dem Elsaß, sind nach der keltisch-germanischen Sonnengottheit Belenus-Baldor-Balder benannt. Zwischen Schwarzwald, Vogesen und Schweizer Jura, tragen fünf Berge den Namen Belchen, eine Namensform die sich zurückführen lässt auf das personifizierte kelt.-germ. Lichtprinzip Beleus / Beleneus / Belenos / Belakus / Baldur, aus indogerm. Sprachwurzel „bhel“ = glänzend / schimmernd / leuchtend, die ebenso in Verbindung zu stehen scheint mit der babylon. Berg-, Sonnen- und Schöpfergottheit Baal. Die alten Weisen haben ganz unverkennbar die Gipfel als Kalenderberge in Gestalt eines großräumigen Beobachtungssystems für ihren Sonnenkalender genutzt und mit dem Namen des uralten Lichtgottes versehen. Zwei nicht weit voneinander liegende Vogesenberge scheinen als abwechselnde Beobachtungsstandorte gedient zu haben: der Elsässer, sog. „Welscher Belchen“ („Ballon d'Alsace“) und der „Große-Belchen“ („Grand Ballon“). Vom Elsässer Belchen aus gesehen beginnt die Sonne ihren jährlichen Lauf wenn sie zur Wintersonnenwende am 22. Dezember über der „Belchenflue“ (bei den Einheimischen „Bölchen“ geheißen) im Jura aufgeht. Zur Frühlingsgleiche am 21. März erhebt sie sich hinter dem exakt östlich liegenden Schwarzwälder Belchen. Dann wandert der Sonnenaufgang weiter Richtung Norden, um zum Sommeranfang des 1. Mai (gallogerm. Fest „Beltene“) über dem Großen Belchen zu stehen. Der nördlichste Sonnenaufgangsfixpunkt ist erreicht zur Sommersonnenwende am 21. Juni hinter dem Kleinen Belchen („Petit Ballon“) im Elsass. Dann sinken die Aufgänge wieder nach Süden hinab, um zum Erntebeginnfest (gallogerm. Fest „Lugnasad“) auf dem Großen Belchen zu liegen. Später erreichen sie den Herbstgleiche-Stand am 23. September wieder genau hinter dem Schwarzwald-Belchen. Zu den genannten Äquinoktien und Solstitien geht die Sonne, von den jeweiligen Belchenbergen aus beobachtet, hinter dem „Ballon d'Alsace“ unter. Für die Beobachtungen des Winterbeginns am 1. November (gallogerm. Fest „Samhain“) sowie des Frühlingsbeginnes am 1. Februar (gallogerm. Fest „Imbolc“) musste man den „Großen Bechen“ besteigen, um die Sonne hinter dem Elsässer Belchen untergehen zu sehen. Alle diese Daten hat die Bochumer Sternwarte im Jahr 1979 überprüft und bestätigt.
Asperg liegt in der Region Stuttgart zwischen den Flüssen Neckar und Enz im mittleren Neckarland. „Schicksalsberg der Schwaben“ wird der Hohenasperg (356 m) genannt. Schon 500 v.0 war er ein Fürstensitz mit Fluchtburg von mächtigen Keltenherren. Erstmalige Nennung erfolgte 819 als „Assesberg“ in einer Schenkungsurkunde des Klosters Weißenburg im Elsaß. In der „Cosmographia des Geographs von Ravenna“ wurde um 700 eine Ansiedlung „Ascis“ vermerkt, die mit Asperg sehr wohl identisch sein könnte. Graf Ulrich I. wählte ab 1260 die Höhe als Herrschaftssitz und trägt die Bezeichnung „Graf von Asperg“, die entstandene Ansiedlung wurde 1304 schriftlich als „Stadt Asperg“ bezeugt. Auf der kleineren Erhebung „Kleinaspergle“ befindet sich ein Hügelgrab eines Durchmessers von 60 m und einer Höhe von 7,60 m. Er ist von einem 1,20 m tiefen und 2,50 m breiten Kreisgraben umgeben. Vom gewaltigen keltischen Hügelgrab bei „Hochdorf an der Enz“geht Richtung Osten ein freier Blick auf den Fürstensitz des Hohenasperg. Das dortige Keltenmuseum gibt einen Überblick über die Lebensweise der Kelten und zeigt in einer gläsernen Vitrine das originale Skelett des Fürsten. Ein weiteres Prunkgrab der Keltenzeit wurde im Gebiet Grafenbühl entdeckt. Auch hier fanden sich einzigartige Stücke, beispielsweise zwei aus Bein geschnitzte Sphingen, eine davon mit aufgesetztem Bernsteingesicht. In der Umgebung des Hohenaspergs sind rund 400 alte Siedlungen nachgewiesen worden. Vieles spricht dafür, dass wir es hier auch mit einem alamannischen Kultplatz „Asenberg“ zu tun haben, der nach ihrem Gott Wodan, dem Asen, benannt war.
Um 20 km östlich von Nürnberg liegt die Gemeinde Ottensoos, die im Jahre 903 vom ostfränkischen König Ludwig IV., das Kind (893-911), an das Regensburger Kloster „St. Emmeram“ verschenkt wurde. Seine Mutter war die Konradinerin Oda/Ota/Uta, die sich u.a. stark machte, die Privilegien des Klosters Altötting zu wahren, das auf dem germ. Kult- und Thingplatz „alten Oding“ (748, lat. Autingas) errichtet worden ist. Zurück zu Ottensoos, Amt Herspruck (976, Haderihesprucga), dessen alter Name Odensoos/Odensos war. Der über dem Südufer der Pegnitz liegende Ort gehört zu den ältesten schriftlich belegtenPlätzen der Region und wurde bereits sehr früh besiedelt, wie Bodenfunde belegen. Odensoos könnte Oden-Sumpf meinen, denn das Wort Soos bedeutet im deutschen Egerländer Dialekt Moor oder Sumpf.Die Örtlichkeit erhielt ihre Bedeutung wegen der Lage auf der Verbindung Nürnberg-Prag, die als Goldene Straße" bekannt war und als eine der wichtigsten europäischen Handelsrouten galt. Zur Zeit Kaisers Karl IV. mussten die böhmischen Könige und Kaiser ausschließlich auf dieser Strecke zu Reichstagen und Kaiserwahlen in Nürnberg anreisen.Wenige Kilometer westlich davon liegt das urkundlich erstmalig 1287 erwähnte Dorf Oedenberg, mit dem seit 1177 beurkundeten „Schottenschloss Oedenberg“, hoch über dem Sebalder Wald. Beispielhaft für die Kultplatztheorie dürfte Altötting in Bayern sein. Der Kernbau dortiger Kirche ist um das Jahr 700 als Oktogon, als achteckiger Turm entstanden. Er ist wohl der älteste bestehende Kirchenbau im rechtsrheinischen Deutschland. Sein achteckiger Grundriss weist auf die ursprüngliche Bestimmung als Taufkapelle hin. Der Legende nach hat hier der fränkische Christenagent Bischof Rupert den ersten christlichen Bayernherzog namens Theodo (Regierungszeit: 696-718) getauft. Bis ins 20. Jh. hinein haben die Herrscher Bayerns nach ihrem Tode ihre Herzen in silbernen Urnen in den Wandnischen der Altöttinger Kapelle beisetzen lassen, als „fürstliche Ehrenwache“. Der Ort muss demnach schon damals von erheblicher Bedeutung gewesen sein. Urkundlich tritt Altötting 748 ins Licht der Geschichte, unter dem Namen Autingas, der latinisierten Form von Ötting bzw. Oetingen, einer Pfalz der agilolfingischen Bayern-Herzöge. Der Name geht, wie man mutmaßt, auf den Eigennamen eines Oto oder Odo zurück, der entweder als schlichter „Gutsbesitzer“ erklärt wird, oder hier als erster bajuwarischen Stammesführers gesiedelt haben soll. Die Ansilben „od-“ / „ot-“ zu „aud-“ / „aut-“ schwanken in germ. Sprachen. Den skirischen Namen Odoaker, got. Audawakr, ahd. Otacher, könnte man mit „Gemüts- bzw. Seelenwacher“ erklären -, aus ags. „oð“ / „oeð“, altnord. „önd“ = „Atem / Geist / Hauchseele“, lat. „anima“ = „Hauch / Wind / Seele“. Johann Georg Turmair, genannt Aventinus (1477-1534), ein deutscher Historiker und Hofhistoriograph, schuf die Altöttinger Chronik, die „Historia Otingae, Munich, 1528“. Er schrieb in der deutschen Version 1519 von dem „hochwirdigen und weit berumten Stifft Alten Oting …“. Der Platz Ötting-Oting war häufiger Aufenthaltsort und Regierungssitz des Herzogs. Gegen Ende des 8. Jh. übernahmen die fränkischen Könige aus dem Haus der Karolinger die Macht und bauten den Ort weiterhin zum Herrschaftszentrum aus. Ihre größte Zeit erlebte die Karolingerpfalz, als König Karlmann, der Urenkel „Karls des Großen“, 865 seinen kompletten Regierungssitz von Regensburg nach Oting verlegte und von hier aus bis zu seinem Tode 880 als König über Bayern und Italien herrschte. Der politische Glanz von Alt-Oting bzw. Altötting währte nicht lange, beim Ungarnsturm 907 wurde der gesamte Ort mit Pfalz, Stift und Basilika verwüstet.
Ob diese Ortsbezeichnung wirklich nur auf einem Gründer namens Oto basiert, ist angesichts der Gesamthistorie, sehr in Frage zu stellen. Eher müsste man annehmen, dass solch ein bedeutungsvoller, schon altheiliger Platz, auch vom Namen her auf wichtigere, eben altreligiöse Bezüge hinweist. Auch hier dürfte die altheilige Anlautsilbe „od-“ / „oð-“ vorliegen, die Zentrallautung des germ. Gottesbegriffes Wodan / Wodin / Odin / Godin / Gott. Es handelt sich um eine Wortform die bis hin zur Gottesbotschaft nachweisbar ist, nämlich dem geistigen „Gottes-Kind“ (Od-Ing), dem runischen Buchstabensystem „ODiNG-FUÞARK“ von mindestens dem Beginn unserer Zeitrechnung. Oting-Ötting - oder Eding, wie es mundartlich heißt - war mit Sicherheit in heidnischer Zeit eine hoch bedeutende Heilstätte der Geist- und Seelengottheit, sonst hätte sich dort nicht der bis dahin heidnische Bayern-Herzog Theodo christlich taufen lassen. Der Ort blieb seiner herausragenden Rolle treu und wurde auch in Christenzeiten einer der wichtigsten Wallfahrts- und Gnadenorte Deutschlands. Schon die Pfalzkapelle, die in der zweiten Hälfte des 9. Jhs. geweiht wurde, hatte die „Mutter Gottes“ als Patronin, die noch heute als „Gnadenspenderin Altöttings“ von ansässigen Gläubigen und den herbeiströmenden Pilgern verehrt wird. Um 1330 kam das in Burgund, oder am Oberrhein entstandene, aus Lindenholz geschnitzte, ca. 70 cm hohe frühgotische Bildnis einer „Schwarzen Madonna“ mit dem Kind hierher, das rund 150 Jahre später, i.J. 1489, nach den Berichten von zwei Heilungswundern, zum Wallfahrtsziel ausgebaut wurde.
Unweit der „Gnadenkapelle“ steht die auch schon im 9. Jh. gegründete, doppeltürmige Stiftspfarrkirche „St. Philippus und Jakobus“. Neben ihrem Hauptportal befindet sich die Uhr mit dem berühmten „Tod von Eding“, der in jeder Sekunde einmal seine Sense schwingt. Erstmals ist er in einer Uhrmacherabrechnung von 1664 erwähnt; er scheint aus dem 16. Jh. herzurühren. Auch hier zeigt sich die altheilige bzw. urheidnische Tradition: Die beiden „Heiligen“ Philipp und Jakob sind Ersatzspieler für das indogerm.-germ.-kelt. Dioskurenpaar der Alki, die ihr Symbolzeichen mit der 10. Rune, dem Algiz-Symbol besitzen. Im arioind. Kult nannte man sie Asvins, Söhne des Dyaus. Die Athener hießen sie Anakes, die wendischen Zwillingsgötter hießen Alzes oder Altschis. Man glaubte sie im Sternbild „Zwillinge“ („Gemini“) als Jünglinge zu schauen; im Mittelalter schrumpften die Symbolgestalten des Himmelsbildes zu zwei nackten Kindern, von denen der eine oft die apollinischen Attribute Leier und Pfeil, der andere das herkulische Attribut der Keule in Händen trägt. So versteht es sich, dass auch die kirchlichen Austauschfiguren mit ähnlich verschiedenen Attributen vorgeführt werden: Der zahme „hl. Philippus“ zeigt Kreuz und Buch, während der rüde „hl. Jakobus“ eine Stange oder Keule trägt. Die Alkiz-Rune steht im runischen Kalendersystem auf dem 1. Mai, ein Datum auf das christliche Kalendermacher - in Anlehnung an altgläubige Vorlagen - wiederum Walburga („Glücksbergerin“ aus: ahd. wala, mhd. waleheit / wolheit = nhd. Wohl / Vermögen -, verbunden mit ahd. bergan = nhd. bergen / verwahren / bewahren / schützen), zusammen mit den genannten beiden „Heiligen“, postiert haben. Es handelt sich um die urheidnische Triade der Alki-Zwillinge mit der Göttin. Dieses Schema liegt in Altötting vor: Die „Gottesmutter Maria“ mit den dioskurischen „Zwillingen Phillip und Jakob“. Immer erscheinen die Zwillinge gemeinsam mit einem weiblichen Heilswesen. Die griech. Helena war eine Vegetationsgöttin in Sparta, in der Mythologie galt sie als Tochter des Zeus und der Leda, ihre Brüder waren die Dioskuren Kastor und Polydeukes bzw. Pollux. Anderen Allegorien zufolge wurden Helena und die Dioskuren aus einem oder zwei Eiern geboren. In der altpruzzisch-baltischen Göttersagen sind die Zwillinge, Söhne des Göttervaters Dievs, stets zusammen mit der Sonnentochter Saulytė, sie hilft ihnen bei ihren Geschäften, doch zu ihr haben die „Dieva dēli“ („Gottessöhne“) ein erotisches und aufeinander eifersüchtiges Verhältnis, sie beobachten die Schöne heimlich beim Baden. Der Katholizismus ist, wenn man es recht besieht, in weiten Strecken seiner mythologischen Legenden nur ein denaturiertes bzw. krampfhaft enterotisiertes, also dürftig übertünchtes Heidentum.
Unweit von Altötting liegt der Ort Polling, südl. vom Ammersee gibt es Oderding, heute ein Ortsteil eines weiteren Polling (auch urkundlich: Polding). Dort gründete 750 der Bayernherzog Tassilo III. ein Kloster, wo angeblich eine gejagte Hirschkuh überraschend stehen blieb. Der Name dürfte auf ein altheimisches Phol-ingen, also eine Baldurstätte zurückgehen. Der ahd. Merseburger-Heilsspruch weist Phol als Beiname des Gottes Baldur aus. Im Gemeindewappen ist das Geschlecht der Pollinger durch ihr Wappentier, einem Hirsch mit Lilienzweig, repräsentiert; eigentlich sind es nichts anderes als die altbekannten Attribute des Gottes: Lebensbaum und Sonnenhirsch. Fruchtbarkeitszweig und Hirsch spielten schon im altgriech. Apollon-Kult eine Rolle. Selbst Phol-Balders enge Heilsbeziehung zum Pferd hat sich auch hier bewahrt; gleichgültig ob die Tradition zwischendurch zeitweise abriss. Der „Georgiritt“, mit anschließender Segnung von Ross und Reitern, findet in der Regel jährlich am zweiten Sonntag im April statt. Auch der Ort Hohenpolding, nördl. von München, hieß früher Palding, Polling oder Polding. Ein Bajuware namens Baldo, so meint man seicht und gedankenarm, müsse wohl der Gründer sein. Im Jahr 998 taucht der Name in lat. Form „alto baldingae“ in einer Urkunde auf, in der ein Salzburger Bischof zugunsten des Adeligen „Valherius de Baleding“ auf einen Grundzehent verzichtete. Dann wurde 1154 eine dortige Kirche genannt: „palding ecclesia“ und 1315 wird die Filialkirche in „Balding“ erwähnt. Von hier kam das Geschlecht der Baldinger, das mehrere Jahrhunderte über hohe Stellen in den Reichsstädten Ulm und Nürnberg innehatte.
Der frühe Angehörige eines Grafenhauses im „Nördlinger Ries“, ein „Graf von Oettingen“ an der Wörnitz, wurde in den Jahren 1141/2 aktenkundig als „Ludevicus quidam de Otingin - ein gewisser Ludwig von Oettingen“. Ca. 40 km südwestlich von Öttingen liegt die Stadt Heidenheim an der Brenz und ca. 12. km nordöstlich liegt das Dorf „Heidenheim am Hahnenkamm“, wo 752 ein Kloster von dem angelsächs. Geschwisterpaar Wunibald und Walburga gegründet wurde. Wie schon dargelegt, ist Walburga nach ihrem Tod als Heilige mit Wirkungen im deutschen Raum gepriesen worden -; da ihre Verehrung vom neuen christlichen System erlaubt und gefördert wurde, hat ihr das deutsche Kirchenvolk Züge der germ. Muttergöttin angehängt. 1147 heiratete Burggraf Heinrich III. von Regensburg die Tochter des „Ludwig von Öttingen“, der als „comes“ aktenkundig ist. In diese Zeit fällt die Provokation des englischen Papstes Hadrian IV (um 1115-1159) der den deutschen König und Kaiser als Lehnsmann der Kirche niederzudrücken versuchte. Im Juni des Jahres 1158 begann Kaiser Friedrich I., Barbarossa geheißen, in aufgeheizter politischer Stimmung der Deutschen, seinen zweiten Italienzug von Augsburg aus. Mit dem Ausbruch des Papstschismas i.J. 1159 begann das Unheil der Kirchenspaltung -, den maßlosen Machtansprüchen hybrider Kirchenfürsten und der Abwehrhaltung verantwortungsvoller Ordnungskräfte des Reiches. Seither ging ein Riss durch Bürgertum, Adel und Klerus. Der Streit zwischen den Parteigängern des Papstes und Papstgegnern erschwerte das Zusammenleben und schwelte weiter bis zur Reformation Martin Luthers (1517-1648) und der großdeutschen „Los-von-Rom-Bewegung“ des 19. Jhs.. Die Regensburger Adelskreise, auch die Dynastie derer von Otingin-Oettingen, gehörten zeitweise zu den Papstanhängern, die sich gegen die reichstreue Politik Barbarossas sperrig zeigten und von ihm streng gezüchtigt werden mussten. In diesen Jahren brannten die Kirchen von Regensburg nieder. Am Palmsonntag, dem 5. April 1159, fiel der alte Kirchenbau auf dem Freisinger Domberg und Teile der Stadt einem verheerenden Brand zum Opfer. Im gleichen Jahr brannte der Dom zu Speyer und stürzte ein, wobei die Trümmer des Querhausgewölbes viele Kirchgänger unter sich begruben. Auch die Bauarbeiten am Langhaus des Mainzer Domes wurden durch etliche Brände und einen Aufstand im gleichen Jahr gestört und verzögert. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei um Protestanschläge klerusfeindlicher, staufisch-patriotischer Kreise gehandelt haben könnte.
Ca. 40 km Luftlinie nördl. von Altötting liegt Ottering (Gemeinde Moosthenning), das möglicherweise auf einen profanen Otheri zurückgehen soll, wahrscheinlich aber doch ebenso eine Andachtsstätte des Wodan-Odan war. Südlich von München breitet sich Gauting; es ist eine bajuwarische Siedlung des 6. Jhs. Ein 753 urkundlich genanntes Goutingen bezieht sich nicht sicher auf diese Gemeinde. Als Gründer soll hier nun ein Godo (Cotto, Gozzo) mit seinen Leuten gewirkt haben. Dass aber gerade diese Örtlichkeit eine sicherlich hochheilige altgläubige Kultstätte gewesen sein muss, dafür spricht die zeitige Klostergründung. Denn aus dem frühen christl. Missionsdenken heraus setzte man keine Kirche oder ein Kloster in die Ortschaft eines gewöhnlichen Herrn Odo oder Godo, sondern auf den altheiligen Platz des Heidentums, um ihn zu entdämonisieren, zu weihen, den Altgläubigen ihren religiösen Stützpunkt abzunehmen und ihn für den eigenen Kult zu vereinnahmen. Wie hochbedeutsam sich gerade Gautig selbst einschätzte, geht aus der Legende hervor: Karl, der herrschgewaltige Frankenkaiser, sei hier 742 geboren worden. Auch an anderen Orten sind bekanntlich Erinnerungen an Gott Wodan auf „Karl den Großen“ übertragen worden. Er geisterte weiter durch das Denken des Volkes, anfangs sehr bewusst, späterhin wohl in zunehmend unerkannter Art und Weise. Und was war eigentlich der „Mauritius-Speer“ - die „sacra lancea“, jene wichtigste Insignie des Reiches der Deutschen - das man offiziell ab Mitte des 13. Jhs. „Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ“ nannte -anderes als das in christliche Zeit mitgenommene Hauptattribut des alten Wodan, den alles durchdringenden Geistspeer „Gungnir“ ?! Vertrauen und hoffen wir auf dieses tiefsinnige Kennzeichen des Herrn des Geistes und der Geister, dass er uns mehr und mehr Klarheit schaffe, und dass er uns den Weg weise aus der christlichen Täuschung und Verfremdung zur alten Wahrheit um uns selbst.
NACHWORT:
Anstoß zum Überdenken war die Nachricht aus eddischer Mythologie vom Gotte Óð / Óðr. Der Umstand, dass er mit Óðinn nicht gleichgesetzt werden kann und als Ehemann der allgerm. Muttergöttin Feija-Freyja galt (Vsp. 25), erweist seinen Ursprung aus einer voraltnordischen, viel älteren, wahrscheinlich schon gemeingerm. Schicht. Auch Jan de Vries erklärte: „Óðr ist eine alte Gottheit, aus ihm ist Óðinn hervorgegangen.“ (Jan de Vries, „Altgerm. Religionsgeschichte II“, 1957, S.87) Sein Begriff weist ihn als Seelen- und Geistgott aus, denn altn. „óðr“ ist das Seelenleben und wohl auch der Verstand. In Vsp. 18,4 werden dem ersten Menschenpaar die Gottesgaben zuteil: „önd gaf Oðinn, óð gaf Hœnir, lá gaf Lóðurr oc lito góða“ = „Atem gab Odin, Seele gab Hönir, Lodur die Wärme und gute Farbe“. Odin-Wodan schenkt Atem / Leben / Seele, während die beiden anderen göttlichen Erscheinungsformen, Hönir („der Schwanengleiche“) und Lodur (der Fruchtbringende; germ. „lôdiz“, altn. „lôð“ = Frucht / Ertrag) Geist / Seele sowie Wärme und Farbe geben. (Der Schwan als Seelenbringer: Alarich Augustin, „Germanische Sinnbilder als Hofgiebelzeichen - Das Schwanengiebelzeichen in Niederländisch-Friesland“, 1942, S. 90ff) Wie wären Sinn und Seele genau zu scheiden ?! Dazu schreibt der Isländer Sigurdur Nordal: „önd, óðr: Hier wird eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Lebensodem und der Seele. önd bestimmt die Lebensfunktionen, ist Teil des Lebens und ist Mensch wie Tier gemeinsam. óðr ist der ,göttliche Funke‘ im Menschen, der auf höhere Mächte zurückgeht.“ (Sigurdur Nordal, „Völuspa“, 1980, S.48) „Óðrörir“ = Seelenerreger, heißt der mythische Trank aus dem Speichel aller Götter, der höchste Gelehrsamkeit, Weisheit und Dichtkunst schenkt. Von diesem vortrefflichen Met trank Odin, da begann sein Geist zu wachsen, er fühlte sich wohl, ein Gedanken führte ihn zum nächsten und er kettete Werk an Werk (Hávamál 140-141). Mit dem Begriff altn. óðr, germ. „wôða“= Gesang, wurden Gesang und Dichtung bezeichnet und als Adjektiv beschrieb man damit Seelenerregungen wie: erregt / wütend / rasend / toll. Im heutigen schwed. Wortschatz gibt es noch „odon“, die Rauschbeere. Aus dem germ. „auda“, was Heil, Glück und Segen bedeutet, wurde „od / ot / oð“. Im Althochdeutschen meint „ot“, „od“, „oda“ = Urbesitz und „ōt“ = Glück / Fruchtbarkeit / Erfolg (Grimm 890), mit ins Sakrale gehenden Überhöhungen: ahd. „ōtag“ = selig, ags. „audagei“ = Seligkeit, „wiz-od“ / „wit-od“ ist die Weisheit, das Wissensgut, altsächsisch „odeke“ besagt die Glückseligkeit. Der einstmals hohe Wert des altheiligen Wortes „Od“, die Zentralsilbe der Begriffe „Goð“, „Wodan“, „Godan“, „Gott“, ist verloren gegangen, er wurde von der Christenkirche teils negiert, teils verteufelt. Er lugt nur noch da und dort wie ein scheues Kind aus einem Eckchen unseres Sprachraumes hervor. Dazu gehört das „Klein-od“, die Kostbarkeit -, der „Odem“ (altengl. oðian), der Lebenshauch -, der „Odermennig“ (mhd. odermenie), das Heilkraut -, der „Od-bero“ (ahd. otibero), der Storch als Kinderglückbringer -, das „All-od“ (ahd. allodium), das volle Gut -, das Ot-ing (Wandlung zu Eding / Ötting), das Weihtum / die Tempelstätte / der Kultort. Im Laufe der Verübelung des Wortes kam es dann zu mhd. „œdene“, nhd. Öde / Wüste, mhd. „œden“, nhd. „öden“ = veröden / verheeren / verwüsten, zu mhd. „œdlīch“, nhd. = eitel / töricht / widerwärtig ? In niederl. Friesland ist der Familienname Oding, Odink, Odinga bis mindestens ins 18. Jh. zurückzuverfolgen. Auch im Münsterland-Westfalen taucht der Name Oding im 18. Jh. auf. Besonders in der alten Vornamensgebung erhielt sich in schöner Fülle das gute Omen welches die Menschen ihren Kindern mit auf den Lebensweg geben wollten: Odoaker (5. Jh.), Odilia (6. Jh.), Kaiserin Oda (899), Frankenkönig Odo v. Paris (9. Jh.), Otto I. der Große (10. Jh.), Odelhildis v. Ascheberg (Anfag 13. Jh.), Odilberga, Otberga, Otburga, Ottberge, Ottburga, Odilberta, Odilgard, Otfrid, Odilon, Ottokar, Otakar.
In zwei Schriften aus dem 15. Jh. ist dokumentiert, dass am Nordrand des Harzes, auf dem Großen Burgberg des heutigen Bad Harzburg, das Bildnis eines sächsischen Gottes gestanden habe. Die Sachsen-Chronik von Conrad Bote aus dem Jahr 1492 berichtet, dass um 780 „Karl der Große“ auf seinem Feldzug gegen Ostsachsen von dem „Götzendienst“ gehört, das Heiligtum zerstört auf dem „Hartesberge“ eine christliche Kapelle habe erbauen lassen. Bei dieser Gelegenheit, so heißt es, beschimpfte Karl die Einwohner: „Crodo ist euer Gott, der Crodo Teufel." Ob dieser Begriff ableitbar ist von „de Grote“ (der Große), oder im schmähenden Sinne, von „de Cröte“ (die Kröte), ist nicht mehr sicher zu erraten, doch scheint die letztere Annahme naheliegend, so dass der Heidenhasser Karl den altheiligen Gottesbegriff „Oto / Odo“ zum „Croto“ verschandelte.