20.01.2015
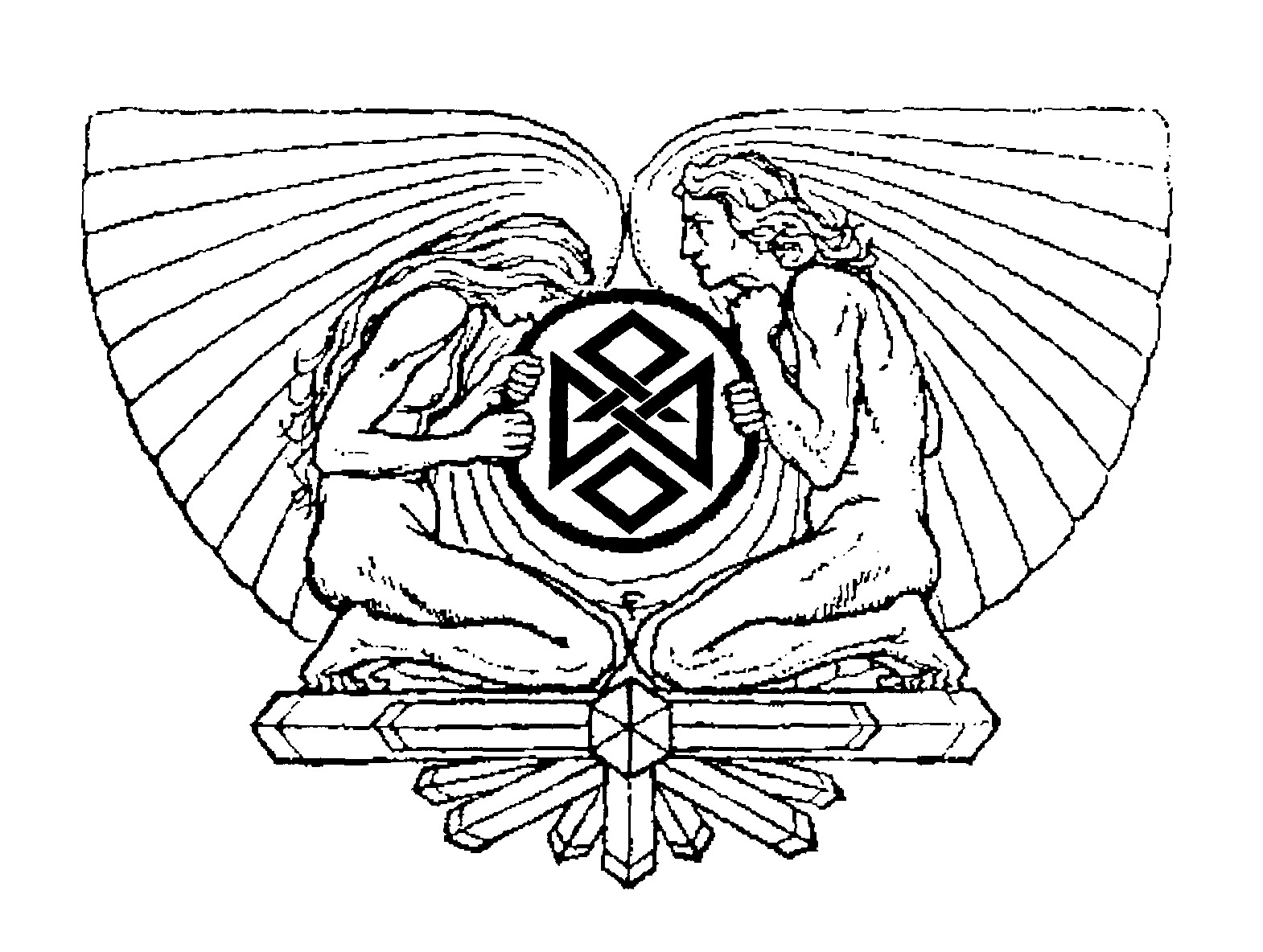
SUCHE NACH DER URWAHRHEIT
(Einleitungsworte zum ODING-WIZZOD)
Die uralt-erhabenen Gedanken, die Gottheit sei „Raum und Zeit“, ihr Schritt aber wäre aus dem Auf und Ab des Jahrganges herauszulesen, lagen noch jenseits meiner bewussten Wahrnehmung. Und doch lockten mich seit Jugendjahren, ganz unverständlich drängend, brennend die Geheimnisse unseres abendländischen Brauchtums- und Kultkalenders mit den offensichtlichen oder auch nur erahnten Überlagerungen, Verfälschungen, Missverständnissen, als würde mir seine Entschlüsselung so etwas wie eine quellreine Urwahrheit schenken können. Dem Gott, dem ich als Messdiener dienen sollte, wurden Hymnen in lateinischer Sprache gesungen und die zu ihm gehörenden frommen Legenden spielten in einem mir völlig gleichgültigen fernen orientalischen Land. Wenn es gelänge, die im Zuge der Gewaltsamkeit des einstigen Glaubensumbruches verfälschte Zeitwährung zu entlarven, so schien mir, müsse zwangsläufig die von flickschusternder Künstelei und Kniffelei befreite, klare Gottesgestalt unserer eigenen Heimatreligion hervortreten. Ich begann einen langen Weg durch die Fachliteratur und suchte gleichzeitig Begegnungen mit den, wie ich glaubte, wenigen wahren Wissensträgern im Lande.
Anlässlich der Eröffnung seines Ur-Europa-Museums in Fromhausen/ Nordrhein-Westfalen lernte ich 1974 den neunzigjährigen Geistesurgeschichtler Herman Wirth kennen - einen Mann im Besitz grenzenlos anmutender Wissensschätze - und, trotz seines hohen Alters, blitzenden blauen Jünglingsaugen. Er war Gründer der Sammlung „Deutsches Ahnenerbe". Ich glaubte mich am Ziel, dachte, ich hätte meinen Lehrmeister gefunden. In Gesprächen am Tisch seines Häuschens am Fuße der Burg Lichtenberg bei Kusel, erklärte er mir seine Auffassungen. In Gestalt vieler geheimnisvoll anmutender Felsbildabgüsse führte er mir die Belege vor. Ich war fieberhaft erregt. Was ich erfuhr, erschien mir ein unsagbar großes Geheimnis. Er verband einstige Schriftzeichen, die Runen, mit uraltgläubiger, Jahresorganisation. Doch ich begriff, dass mein Wissen nicht ausreichte, ihm folgen zu können. Ich bat ihn, um einen handlichen Beweis, um Nennung einer Art Kernstück seiner Erkenntnistheorie. Er verwies, ebenso wie er es in sämtlichen seiner umfangreichen Schriften getan hatte, auf die skandinavischen bronze- und eisenzeitlichen Felsbildritzungen (ca. 1600-500 v.0) - insbesondere auf jene Darstellung einer kreisrunden Scheibe, um welche, wie er meinte, kalendarische Frührunen gruppiert seien. Er schätzte sie auf ein steinzeitliches Alter. Die von ihm als „Kalenderscheibe bei Fossum“ bezeichnete Darstellung liegt im südwestschwedischen Bohuslän. Wirth vermittelte mir das wichtige Verständnisprinzip alter Religiosität: Den Jahresgott, der geboren wird, im heilspendenden Gang die Zeit durchschreitet, schließlich den Opfertod erleidet, um - gleich den neu emporwachsenden Sonnenlichtbögen - wiedergeboren zu werden. Und dies sei der Glaube einstmals gewesen, dass auch die Menschenseele dem göttlichen Vorbilde gemäß, wieder auferstünde, zu ihrer Zeit.
Im Sommer 1982 reiste ich das erste Mal nach Skandinavien, um die von meinem Meister bezeichneten Felsbilddokumente mit eigenen Augen anzusehen. Kurz zuvor war ich mit einem handwerklich geschickten Manne - Dietrich Evers - bekannt geworden, der sich experimenteller Archäologie verschrieben hatte. Er zeigte mir, wie man durch Papierabriebe zur detailgetreuen Aufnahme von Felsbildgravuren gelangen kann. In der Folgezeit nahm ich Hunderte der aussagefähigsten Abbildungen auf, um sie zu Hause in aller Ruhe studieren zu können. Endlich stand ich also am Ziel, im schwedischen Bohuslän, bei Tanum, in Fossum - die Zeugnisse der germanischen Frühzeit zu meinen Füßen. Ich fuhr mit tastenden Fingerspitzen die Ritzlinien des Felsbildes entlang. Ich weiß nicht, ob ich damals wirklich geweint habe, aber mir war nach Weinen zumute. Ein Traum zerrann. Nicht ein einziges der von Herman Wirth nachgezeichneten und beschriebenen Zeichen seiner „Kalenderscheibe“ war in der von ihm dargestellten Form vorhanden. Unübersehbare Bildteile hatte er freiweg unterschlagen. Weil sie in seine Runentheorie nicht hineinpassen wollten ? Ähnlich verhielt es sich auch bei anderen seiner Felsbildwiedergaben. Ich war zutiefst deprimiert. Keine Ur-Runen, kein Ur-Kalender. Sehr viel später erst fand ich im Nachlass des Verstorbenen eine Nachtfotografie der Fossum-Ritzung, welche durch einseitige Beleuchtung zustande gekommen war und die gleichen falschen Gebilde aufwies, wie sie Wirth stets beschrieben und gedeutet hatte. Etliche Jahre, bevor er die Felsen selbst in Augenschein nehmen konnte, muss er von einer schlechten Ablichtung irregeführt worden sein. Ich war damals erschüttert und aufgewühlt, ich legte meine brennende Stirn einen Moment auf die kühlende Felsfläche und versuchte zu dem mir unbekannten Gott meiner Vorfahren zu beten: „Wenn Du bist, Wodan, du Geist der Erkenntnissucher, so bitte ich, lass mich trotz meines Fehlganges deine Runen und dein Kreisgang durch das Jahr erkennen !“
Stundenlang lag ich in diesen Urlaubstagen vor meinem Zelt und starrte auf die von Herman Wirth ringförmig angeordneten 24 Runenzeichen. Tag für Tag wanderte ich mit Karte und Kompass durch die geheimnisvoll wuchernden schwedischen Wälder um nach den oft gut verborgenen Felsbildern unter Laub, Moos und zuweilen dicken Humusschichten zu suchen. Währenddem hatte ich viel Zeit zu sinnieren. Wenn im Runenkreis wirklich ein kalendarisches oder weiterreichendes Geheimnis verborgen lag, so durfte es allein im ursprünglichsten Vermächtnis gesucht werden, nicht aber in den jüngeren, erst im 8. Jh. aufgekommenen Runenreihen. Diese stammen aus Zeiten des aggressiven kirchenchristlichen Vorstoßes und geistiger Zurückdrängung des europäischen Altglaubens. Aus solchen Schwundphasen durfte ich nichts Ursprüngliches erwarten. Ebenso wusste ich, dass das natürliche Sonnenjahr, und somit auch das Kalenderverständnis der Alten, in der Phase des tiefsten Lichtstandes seinen Anfang nahm. Das Jahr ist ein Erzeugnis von Sonne und Mond. Die vom irdischen Beschauer wahrzunehmende Lichtzunahme beider Gestirne beginnt aus deren niedrigsten Stand, also aus Neumondnächten, welche der Wintersonnenwende (21. Dez.) am nächsten liegen. Für den Nordlandbewohner ist es unmöglich, den Gang des jährlichen Sonnenheiles aus anderem Zeitort als dem Südpunkt, dem scheinbaren „Sonnengrab“, heraufsteigen zu sehen. Mir schien also der Anfang sicher, von dem beginnend sich die 24 Zeichen über die 24 Halbmonate des Jahreskreises zu verteilen hatten.
Die zweihälftige, Jahr-Rune ( ) stand dann auf der Jahreshöhe, der Sommersonnenwende. Wirklich könnte man von einer Jahresspaltung sprechen, endet ja hier die Lichtzunahme, tritt doch das Jahr von hier in seinen Abschwung ein. Trotz dieser Bestätigung schienen mir einige Runen am unpassenden Ort postiert: Die Rune des Tiu / Tyr (
) stand dann auf der Jahreshöhe, der Sommersonnenwende. Wirklich könnte man von einer Jahresspaltung sprechen, endet ja hier die Lichtzunahme, tritt doch das Jahr von hier in seinen Abschwung ein. Trotz dieser Bestätigung schienen mir einige Runen am unpassenden Ort postiert: Die Rune des Tiu / Tyr ( ), der dem röm. Mars gleichgesetzt wurde, befand sich beim September-Anfang, die Asenrune Wodans (
), der dem röm. Mars gleichgesetzt wurde, befand sich beim September-Anfang, die Asenrune Wodans ( ) lag auf Ende Februar. Die erste müsste eigentlich zum März, zumindest ins Frühjahr gehören, und die zweite in die Nähe herbstlicher Michaels-Feste, denn diesen Erzengel versteht man allgemein als christliche Austauschfigur für den heidnischen Seelengeleiter und Totengott (Wodan / Mercurius / Hermes).
) lag auf Ende Februar. Die erste müsste eigentlich zum März, zumindest ins Frühjahr gehören, und die zweite in die Nähe herbstlicher Michaels-Feste, denn diesen Erzengel versteht man allgemein als christliche Austauschfigur für den heidnischen Seelengeleiter und Totengott (Wodan / Mercurius / Hermes).
Also wendete ich versuchsweise den Runenkreis, damit Zeichen der absteigenden Jahresseite in die aufsteigende und Zeichen der aufsteigenden in die absteigende Hälfte überwechselten. Jetzt, im gekonterten Symbolkreis, begann zwar die Runenlesung mit dem o (.jpg) ), das bisher als Endbuchstabe galt, doch wäre es nicht naiv, wenn wir annehmen würden, die Runen - das germanische Geheimnis schlechthin - seien ohne jegliche Tarnung der Allerweltsbetrachtung preisgegeben worden ? Die esoterische Lesung von „rückwärts“, die von rechts nach links verlaufende, hätte sich der Runenschöpfer als schlichte Verschlüsselungsmethode wohl einfallen lassen können. Erst sehr viel später erfuhr ich, dass die Linksläufigkeit ein Charakteristikum aller alten Schriften ist.
), das bisher als Endbuchstabe galt, doch wäre es nicht naiv, wenn wir annehmen würden, die Runen - das germanische Geheimnis schlechthin - seien ohne jegliche Tarnung der Allerweltsbetrachtung preisgegeben worden ? Die esoterische Lesung von „rückwärts“, die von rechts nach links verlaufende, hätte sich der Runenschöpfer als schlichte Verschlüsselungsmethode wohl einfallen lassen können. Erst sehr viel später erfuhr ich, dass die Linksläufigkeit ein Charakteristikum aller alten Schriften ist.
Im versuchsweise angedachten rechts-beginnenden bzw. linksläufigen Kalenderrunenreigen drohte die Hagel-Rune ( ) auf Ende Juli, Anfang August. Das konnte die Lösung wohl doch nicht sein, ein Hagelzeichen schien mir nicht in den Hochsommer zu passen. Nach Urlaubsende recherchierte ich bei der Agentur einer Hagelversicherung. Die Auskunft des Sachbearbeiters war für mich überraschend und erlösend: „Dem einfachen Erfahrungswert entsprechend, entstehen die meisten Hagelschäden in der Zeit Juli-August.“ Von diesem Augenblick an war ich fest überzeugt, den Sinn der Runenreihe erkannt zu haben. Das Strukturprinzip des Zeichensystems erschien mir jetzt durchschaubar. Unter dem begeisternden Eindruck meiner Findung verschickte ich im März 1983 an Freunde und Interessenten einen ersten wiedergeborenen Runenkalender, nach verborgenem Dahindämmern über mindestens 1500 Jahre. Die Unsicherheit aber blieb, inwieweit meine Hypothese jemals im strengen Sinne beweisbar sein würde. Mein unermüdlicher Freund und Lehrer, der im Alter zutiefst vaterländisch empfindende Kurt Kibbert, Wissenschaftler am Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Frankfurt, beantwortete mir geduldig viele Fragen und vermittelte insbesondere Verständnis für das Werk von Heinz Klingenberg: „Runenschrift, Schriftdenken, Runeninschriften“, in dem die zahlenmythologisch-gematrische Dimension alten Runendenkens nachgewiesen erschien. Während einer Studienfahrt im Frühjahr 1986 zur Fundstelle des goldenen Runenhornes von Gallehus/Rosengaard in Nordschleswig, lernte ich den profunden Philologen und erfolgreichen Forscher selbst kennen. Jetzt endlich glaubte ich das zweite Standbein für die Nachweisbarkeit der linksläufigen Ur-Runenreihe gefunden zu haben. Über die Mathematik der Runenzahlen würde ich es beweisen können.
) auf Ende Juli, Anfang August. Das konnte die Lösung wohl doch nicht sein, ein Hagelzeichen schien mir nicht in den Hochsommer zu passen. Nach Urlaubsende recherchierte ich bei der Agentur einer Hagelversicherung. Die Auskunft des Sachbearbeiters war für mich überraschend und erlösend: „Dem einfachen Erfahrungswert entsprechend, entstehen die meisten Hagelschäden in der Zeit Juli-August.“ Von diesem Augenblick an war ich fest überzeugt, den Sinn der Runenreihe erkannt zu haben. Das Strukturprinzip des Zeichensystems erschien mir jetzt durchschaubar. Unter dem begeisternden Eindruck meiner Findung verschickte ich im März 1983 an Freunde und Interessenten einen ersten wiedergeborenen Runenkalender, nach verborgenem Dahindämmern über mindestens 1500 Jahre. Die Unsicherheit aber blieb, inwieweit meine Hypothese jemals im strengen Sinne beweisbar sein würde. Mein unermüdlicher Freund und Lehrer, der im Alter zutiefst vaterländisch empfindende Kurt Kibbert, Wissenschaftler am Institut für Vor- und Frühgeschichte der Universität Frankfurt, beantwortete mir geduldig viele Fragen und vermittelte insbesondere Verständnis für das Werk von Heinz Klingenberg: „Runenschrift, Schriftdenken, Runeninschriften“, in dem die zahlenmythologisch-gematrische Dimension alten Runendenkens nachgewiesen erschien. Während einer Studienfahrt im Frühjahr 1986 zur Fundstelle des goldenen Runenhornes von Gallehus/Rosengaard in Nordschleswig, lernte ich den profunden Philologen und erfolgreichen Forscher selbst kennen. Jetzt endlich glaubte ich das zweite Standbein für die Nachweisbarkeit der linksläufigen Ur-Runenreihe gefunden zu haben. Über die Mathematik der Runenzahlen würde ich es beweisen können.
O-D-Ing
So wie die Gesamtheit unserer gebräuchlichen griechisch-lateinischen Schriftzeichen nach ihren Anfangslauten A-B-C genannt wird, müssten die germanischen Runenbuchstaben nach ihren drei ersten Stäben O-D-Ing heißen. Ihre Durchnummerierung ermöglichte die bessere Verständlichmachung jedes Zeichens nach den Regeln antiker Zahlenspekulationen. Mindestens seit Pythagoras (550-500 v.0) verbanden die Griechen mit gewissen Zahlen ganz bestimmte Ideenbilder. Nun zeigte die ODING-Runenreihe bei sämtlichen Buchstabe ein hohes Maß von Verständnisübereinstimmung mit dem jeweiligen hellenistisch-gnostischen Zahlensinn, der im urgermanischen Denken ebenso zu Hause war, wie H. Klingenberg bewiesen hatte. Da verband sich wirklich die Zahl 1 mit der Urschlinge des Weltgewebes ( ), die 2 mit des polaren Tagvaters Doppelaxtzeichen (
), die 2 mit des polaren Tagvaters Doppelaxtzeichen ( ), die 3 mit dem solaren Erlösersohn Frô / Freyr (
), die 3 mit dem solaren Erlösersohn Frô / Freyr (.PNG) ), die Materiezahl 4 mit dem Wasser- und Pflanzenzeichen (
), die Materiezahl 4 mit dem Wasser- und Pflanzenzeichen ( ), die Menschenzahl 5 gehörte dem germ. Urvater Mannus (
), die Menschenzahl 5 gehörte dem germ. Urvater Mannus ( ), die Hochgotteszahl 8 dem Himmelsherrn Tiu / Tyr (
), die Hochgotteszahl 8 dem Himmelsherrn Tiu / Tyr ( ), und die magische Kronenzahl des Weltgeistes 21 markierte den Großen Asen, den Ahnengeist-Weltgeist Wodan / Wodin / Odin (
), und die magische Kronenzahl des Weltgeistes 21 markierte den Großen Asen, den Ahnengeist-Weltgeist Wodan / Wodin / Odin ( ). Seit diesem Erkenntnismoment wusste ich: Eslag nicht nur ein frühes Kalendersystem vor mir, das war mehr: Ein Weltverständnis, eine Gotteserkenntnis -, die echte Urbotschaft, das Evangelium indogermanischer Ahnen, die heilige Urschrift der Deutschen -, und dazu, wahrscheinlich die Kodifikation der Wodanreligion. Eine lange verriegelte Pforte war aufgestoßen, ich durfte hindurchgehen in dieses vermutete alteuropäische geistige Heimatland hinein, um es wieder in bewussten Besitz zu nehmen. Seitdem hat mich das ODING nicht mehr losgelassen.
). Seit diesem Erkenntnismoment wusste ich: Eslag nicht nur ein frühes Kalendersystem vor mir, das war mehr: Ein Weltverständnis, eine Gotteserkenntnis -, die echte Urbotschaft, das Evangelium indogermanischer Ahnen, die heilige Urschrift der Deutschen -, und dazu, wahrscheinlich die Kodifikation der Wodanreligion. Eine lange verriegelte Pforte war aufgestoßen, ich durfte hindurchgehen in dieses vermutete alteuropäische geistige Heimatland hinein, um es wieder in bewussten Besitz zu nehmen. Seitdem hat mich das ODING nicht mehr losgelassen.
Die Übereinstimmung zwischen dem Runenring und dem astrologischen Schema der 12 „Sonnenhäuser“ bzw. dem Sternbilderkreis (Tyr- / Tirkreis) des Himmelsgottes Tiu-Tir-Tyr ist unübersehbar. Daraus wäre zu folgern, dass dem Schöpfer des Runensystems die Fülle des hellenistisch-synkretistischen Wissens zur Verfügung stand. Er wäre zu vermuten etwa zwischen den Jahren 100 bis 50 v.0. Die gesamte Alte Welt rüstete sich damals, besonders gegen Ende dieser Zeitspanne bis 150 n.0, zu ähnlichen Unternehmen. Die im geweiteten hellenistischen Kulturraum zusammentreffenden Religionen traten in scharfen Wettstreit miteinander, sie wollten Gefolgschaften gewinnen, sie predigten und schufen ihre Bücher. In festgelegten Buchstaben begannen die Wissenden einzufangen und schriftlich zu bewahren, was einst der Götter lebendiger Odem war. Die Anhänger unterschiedlichster Kulte stimmten in der Auffassung darinüberein, dass die Prinzipien der göttlichen Ganzheit, der kosmischen Ordnung, in Lautzeichen, den Buchstaben sowieder Zahlennatur jeglichen Dinges fassbar zu machen seien.
Aus stammeseigenen indogermanisch-gallogermanischen Gedankenwurzeln könnte solch eine Idee dem genialen Runenerfinder zugewachsen sein, lautete doch schon ein Begleittext zum Veda, dem arioindischen Buch heiligen Wissens: „Alle Vokale sind Verkörperungen Indras“ (Chandogya-Upanishad 1.22,3), an anderer Stelle heißt es sinngemäß: „Der Werdevater schuf die Welt aus dem Worte“ (Satapatha Brahmana 6.1,1,9), und in der Bhagavad-Gita, dem hinduistischen Hohenliede der gläubigen und vertrauensvollen Gottesliebe, verkündete Krishna: „Ich bin der Anfang, die Mitte und das Ende, das A im Alphabet, der Rede Sinn“ (10.32, 33), etwa 5 Jahrhunderte bevor der Autor der „Offenbarung des Johannes“ seinem Christos die Worte in den Mund legte: „Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende“ (21.6). In engem geistesgeschichtlichem Urzusammenhang scheint der sich abzeichnende ODING-Wodin-Glaube mit den gnostischen Buchstaben- und Zahlenmystikern zu stehen, die sich vom Neupythagoreismus (ab 100 v.0) anregen ließen. Sie verschmolzen Ideen und Zahlen; die Buchstaben sind in der hellenistischen Schulpraxis ja ohnehin als kosmische Elemente angesehen worden, denen „man religiöse Ehrfurcht zollen muss“ (Arist. Polit. 1338a). Schon der Grieche Jambulos (2.Jh.v.0) träumte in einer als Reise, eingekleideten Märchenutopie, von einem idealen dem Sonnengott geweihten Staat auf sieben Inseln, der ein harmonisches, gerechtes Zusammenleben der menschlichen Gemeinschaft ermöglichen sollte. Die Gleichheit würde dort mit größter Konsequenz durchgeführt. Zum Gemeineigentum träte eine für alle gültige Arbeitsdienstpflicht, die Sklaven unnötig mache. Frauengemeinschaft und gemeinschaftliche Kindererziehung zielten darauf ab, das Volk zu stärken. Sein Werk blieb nicht erhalten, nur an Hand einer Inhaltsübersicht, die der Historiker Diodorus (ca.80-30 v.0) gibt, können wir es uns erschließen (II 57,4). Dort heißt es: „es sei bei ihnen auch Sorgfalt für alle Bildung, am meisten aber für die Sternkunde. Als Buchstaben brauchten sie achtundzwanzig, was die Schriftfiguren betreffe, sieben, deren jede vierfach umgebildet werde.“ Jambulos dichtete seinen Wunschinsulanern ein vollkommenes Alphabet an und zeigt damit, dass man in hellenistischer Zeit, wie die alten Pythagoreer, symbolische Beziehungen der Schrift zum Kosmos als sinnreich und schön empfunden hat. Anaxilaos war ein Pythagoreer aus dem nordgriechischen Thessalien, der im Jahre 28 von Kaiser Augustus unter dem Vorwurf, Magie betrieben zu haben, aus Rom verwiesen wurde. Er und Kolorbasos wurden, neben dem Gnostiker Valentinus, als geistige Vorfahren des Zahlen- und Buchstabenmystikers „Markos der Magier“ betrachtet, mit dem, oder seinen Schülern, der christl. Eiferer Irenäus (135-202) im Rhônetal/Gallien zusammengestoßen sein muss (Irenäus haer. 1.14-16,2). Der Gnosislehrer Marsanes (Ende 2. Jh.) wird im Codex Brucianus (Kap. 7) als einer der vollkommenen Menschen erwähnt; es hieß, ihm sei in einer Vision der göttliche „Dreifachkräftige“ (Hermes-Thoth) erschienen. Er huldigte der rein phythagoreischen Zahlenmystik, wie sein Codex Marsanes (NHC 10.1) zeigt. Dieser gehört zu den in Ledersäcken eingehüllten Papyrusbücher die man beim mittelägyptischen Dorf Nag-Hammadi fand. Die Rolle ist in schlechtem Zustand, doch über die Wirkungen der Zahlen ist etwa dies herauszulesen: „Die erste die gut ist, stammt aus der 3. Die 2 aber und die 1 gleichen keinem Ding, sondern sie sind die ersten, die existieren. Die 2 aber, indem sie getrennt ist von der 1 wird zu der Hypostase [Verdinglichung eines gedanklichen Begriffs] gezählt. Aber die 4 hat die Elemente empfangen, die 5 hat Vereinigung empfangen, und die 6 wurde vollkommen durch sich selbst. Die 7 hat Schönheit empfangen, die 8 bereitet ein Übermaß. Und die 10 offenbarte den ganzen Ort...“ Anschließend verbreitet sich Marsanes über die Buchstabenmystik, die er mit himmlischen Kraftmächten in Verbindung setzt. Ein anderer Nag-Hammadi-Kodex (NHC 8.1), vom Anfang 2. Jh., der die iranisch-platonische Himmelsreise des Zostrianos/Zoroaster beschreibt, endet mit einem Kryptogramm dessen Auflösung durch die drei Achterreihen des griech. Alphabetes möglich wird. (Bibel der Häretiker: die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi, eingel., übers., kommentiert von G. Lüdemann u. M. Janßen, Radius-Verlag, Stuttgart 1997) Solch eine Achtereinteilung wurde auch für die Runen typisch, man nannte sie altn. ætt („Geschlecht“). Die Runen-Entstehung fällt ersichtlich in eine Zeit, in der einerseits das neupythagoreische Buchstaben- und Zahlendenken in voller Blüte stand und anderseits das keltisch-druidische Mysterienwissen noch seine ungebrochenen Impulse aussenden konnte. Das wäre nicht viel sehr später als unmittelbar nach der cäsarischen Zertrümmerung der gallischen Welt 50 v.0. Allerdings darf die keltische Einflussnahme auf die abendländische Religionsgeschichte sowohl vor wie auch noch nach diesem Zeitpunkt als bedeutend betrachtet werden. Die Druiden waren eine gut organisierte Priesterkaste in der weiten Keltika von Iberien, Irland, Gallien, Obergermanien bis hin nach Galatien. Ihre Lehren vom Ewigkeitswert der Menschenseele inspirierten mit Sicherheit vielfältige Mysterienkulte. Die im fraglichen Zeitraum wirkenden Bücher und Schulen der Buchstaben- und Zahlenmystik dürften dem Runenschöpfer den unmittelbaren Anstoß gegeben haben seiner eigenen kalendarisch-theosophischen Tradition ein Denkmal zu setzen, ein zeitgemäßes Zeugnis zu schaffen -, wahrscheinlich sogar mit seiner neuen gottesweisheitlichen Schriftordnung ein Leit-, Sehnsuchts- und Musterbild für einen germanischen Gottesstaat zu begründen.
Schlüsselübergabe
Meine Darlegungen würde ich am liebsten verstanden wissen als Schlüsselübergabe zum Einstieg in eine Welt, die noch voller überraschender Entdeckungen sein muss. Wir stehen am Anfang einer neuen Wissenschaft. Am besten hätten mich jene verstanden, welche das ODlNG als Medium der Selbsterkenntnis, der Selbstfindung und Selbststärkung zu nutzen verstünden. Denn im Zentrum des gnostischen Denkens stand und steht der Mensch ! Zur göttlichen Seligkeit wird keiner gelangen, der diese nicht in sich selbst zu finden fähig wird. Es handelt sich hier um das Herzstück der mythischen Urhypothese. Die schon altindische Weisheit, dass Brahman, die letzte äußere Wirklichkeit, mit Atman, der innermenschlichen Wirklichkeit, identisch sei, war Gemeingut der Gnosis und widerspiegelt sich auch im Alōd („in vollem Eigentum stehender, unbelasteter Besitz“) des kosmischen ODING-Kreises.
Hrabanus Maurus (776-856), der fränkische Universalgelehrte und Kirchenmann, erwähnte um das Jahr 840 in seiner Schrift De inventione linguarum, ein Runenalphabet „wie es die Marcomanni - jetzt Nordmanni genannt - gebrauchten, von denen jene abstammen, die die Theodisca lingua sprechen". Nordmanni wurden zu Hrabanus Zeiten die überelbischen Sachsen genannt. Zu dieser Textstelle erklärt Wilhelm W.C.Grimm: „Daraus folgen drei wichtige Sätze: erstlich, daß dies Alphabet für ein ursprünglich deutsches galt; zweitens, daß nur die, welche dem Heidentum zugetan waren, sich dessen bedienten; und zwar drittens, zu einem besonderen Zweck, um ihre Gedichte, Zaubersprüche und Weissagungen damit aufzuschreiben.“ (Wilhelm Carl Grimm, Über deutsche Runen, 1821, S.82) Hrabanus, der Leiter der Klosterschule Fulda (782-842), später Erzbischof von Mainz, verstand also Runenbuchstaben als die Urschrift der Deutschen. Zu seiner Zeit hatten sie zwar der von klerikaler Seite forcierte Ausbreitung des lateinischen Alphabetes weichen müssen, doch noch im 6. Jh. scheinen sie breiter genutzt worden zu sein. Schrieb doch der mit deutscher Sprache und Sitte vertraute Venantius Fortinatus (Bischof zu Poitiers, wohl langobardischer Abkunft, aus Oberitalien, in Ravenna erzogen) an seinen Freund Flavus, wenn er ihm nicht lateinisch antworten wolle, so könne er sich der barbara runa, also der „deutschen Runenbuchstaben“ bedienen. Den Begriff barbara setzte er auch an anderen Stellen seiner Abhandlungen ohne abwertende Bedeutung für „deutsch“ ein. (W.C. Grimm, Über dt. Runen, 1821, S.61ff) Eine Stelle bei Kero (um 720) dokumentiert dann den christlichen Verdrängungskampf gegen die deutschen Buchstaben. Da wird den Mönchen verboten von irgend jemand etwas in Runen (rûnstaba) Geschriebenes anzunehmen. (W.C. Grimm, Üb. dt. Runen, 1821, S.70f)
Von ihnen, dem Verbund runischer Schriftzeichen, meinte der Tübinger Religionswissenschaftler J.H. Hauer in seinem während des Weltkrieges II. geschriebenen Runenbuch: „Darum wagen wir die Vermutung, daß diese Reihe in ihren Grundzügen ein Kernstück der Einweihung der jungen Geschlechter bei den Germanen bildete. Wenn in der Edda von der Einweihung in die Runen die Rede ist, dann handelt es sich nicht nur um die Kenntnis der Runenzeichen und der Runensprache, sondern auch um den tiefen Inhalt, der den Zeichen gemäß der Reihenfolge des Futhark innewohnt. Das Futhark in seinem symbolischen Charakter war sozusagen der Kerbstock der Weisheitsüberlieferung. An Hand dieser Reihe mögen die Lehren vorgetragen worden sein. Man kann mit Recht vermuten, daß im Zusammenhang mit den verschiedenen Zeichen, etwa dem fehu-, uruz-, Thurs-, dem Tyr-, dem Odin-, dem Pferde-, dem ng-Zeichen die großen Mythen über diese Götter erzählt wurden. Auch sie bildeten den tiefen Inhalt oder Hintergrund der Runen.“ J.H. Hauer blieb das Entdeckerglück versagt, er ahnte nicht, dass es weniger eine FUÞARK- als eine ODING-Lehre war, welche einstmals vorgetragen wurde, seine grundsätzliche Vermutung war jedoch richtig.
Einer der bedeutendsten isländischen Gelehrten des 20. Jahrhunderts, der Dichter-Philologe Sigurdur Nordal, schrieb in seinem Kommentar zur eddischen Völuspa über den altnordischen „Asenglauben", den Glauben unserer Vorfahren: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein moderner Mensch nach diesem Glauben leben und sterben könnte, und ich bin nicht sicher, ob nicht die germanischen Völker die alten Glaubensvorstellungen stärker werden berücksichtigen müssen, wenn es darum geht, sich eine zukünftige Weltanschauung zu schaffen.“ (Texte z. Forsch. Bd. 33, Sigurdur Nordal, Völuspa, 1980, S.13) Doch die Gestalt des Runengesetzes, der altgermanischen ODING-Ewa, ist gleichsam nur das Gewand des Gesetztes. Töricht wären jene, die die Auskleidungen für das Gesetz selber hielten; die Weisen schauten auf den Geistleib, den das Runen-ODING umhüllt. Wir werden sehen, dass dieses altgermanische Verständnis als eigenwillig, urwüchsig und einzigartig einzustufen ist. Es ist erklärbar zu machen, indem vergleichbare Ideenmuster daneben gehalten werden, doch es entspricht in Gänze keiner der bekannten zahlenmythologischen und philosophischen Schulen der Antike, vielmehr handelt sich um eine Schöpfung aus wesenseigener Gestaltungskraft.
Wer den Runengeist in seiner Breite und Tiefe verinnerlichen möchte, den wird eine auf gefühlsmäßigen Abstand bedachte, universitäre Gelehrsamkeit wohl nicht zum letzten Ziel führen. Wer es erreichen will, muss Herz und Geist geichermaßen in die alte Zeit zurücklenken. „Ohne Begeisterungsfähigkeit schlafen die besten Kräfte unseres Gemütes, es ist ein Zunder in uns der funken will“, meint Schopenhauer. Ich ließ mich inspirieren und wurde zum Dichter, kleine Reimblöcke sind den religionsgeschichtlichen Absätzen angehängt. Auf nüchterne Geister werden sie wie altertümelnde Sprachschnörkel im Sinne eines Butzenscheibenzierrates wirken. Sie möchten aber eigentlich hilfreich sein zur Einstimmung in die runische Atmosphäre wie ich sie empfand; sie transportieren zudem in verdichteter Form eine Menge zum jeweiligen Runenbezirk gehörender Mitteilungen. Als stilistisches Mittel wurde ein gelegentlicher Rückgriff in den mittelhochdeutschen Wortschatz nicht gescheut, um gewünschte Stimmungen zu erzielen. Für Neugierige, die unbekannte Begriffe unter die Lupe nehmen möchten, gibt es im Anhang die Worterklärungen.
Der Bildteil des Buches ist knapp bemessen. Es sollten mit den skandinavischen Felsritzbildern eine Anzahl ikonographischer Urzeugnisse der germ. Völkerfamilie deshalb Aufnahme finden, weil diese einzigartigen Zeugnisse des Nordens oft eindeutige Beweiskraft besitzen. Zudem geistern etliche in fehlerhaften Formen durch die Literatur und sind zwecks Überprüfung in den schwedischen Wäldern in vielen Fällen nur unter erheblichen körperlichen Anstrengungen erreichbar. Keine andere abbildbare Aufnahmemethode dieser Bilder erlangt nur annähernd die von mir erzielte Genauigkeit, deshalb besitzen in jedem Zweifelsfalle etwaiger Differenzen, die in diesem Buch vorgeführten, uneingeschränkte Gültigkeit. Zu dieser Kunstgattung sagte der profunde Runenkenner Helmut Arntz: „Die skandinavischen Felszeichnungen lassen sich nicht mehr aus ihrer Verbundenheit mit den Runen lösen. Je mehr deutlich geworden ist, daß zwischen ihren Bildern und den Runenzeichen keine formalen Beziehungen bestehn, sind beide als zeitlich aufeinanderfolgende Ausdrucksformen des gleichen Glaubens erkannt worden. Man möchte heute sagen: beide verstärken und verewigen die gleiche Kulthandlung; dort mit Bildern, hier mit Zeichen. Jene geben uns eine unmittelbare Anschauung, diese den Widerhall und manchmal sogar den Klang gesprochener Worte. Aber beide sind nicht um ihretwillen selbst da, sondern sie sind nur Niederschlag des Zaubers, der dem Zauber der überirdischen Mächte entgegentritt.“ (Helmut Arntz, Vom Kult der Sonne, S. 173, in Runenberichte Bd 1, Heft 4, Universität Giessen, 1942)
So möchte ich jetzt die Erklärung der Bauordnung unserer germanischen - und wie sich erweisen wird - auch keltisch beeinflussten Buchstabenreihe ODING-FUThARK, anbieten, „deren Ursache ... noch nicht entdeckt ist“, wie Altmeister W.C. Grimm in seinem Runenbuch von 1821 schrieb (W.C. Grimm, Üb. dt. Runen“, 1821, S.124). Zu deren Erkenntnis ich am Beginn zwar streckenweise wie ein Hingeführter den Weg fand - oftmals zwanghaft fremdbestimmt anmutend - die jedoch arbeitsmethodisch korrekt, in fachwissenschaftlich üblicher Art die Beweise liefert. Dieser erstmals vor aller Augen ins Licht gerückte runische Strukturgedanke schuf ein fein verzahntes, sich gegenseitig stützendes und bestätigendes geistiges Maß- und Netzwerk, ähnlich dem Steingefüge himmelstrebender gotischer Dome. Dessen innere Harmonie gründet sich auf einer so großen tragfähigen Verklammerung, dass meine Rekonstruktion selbst dann unbeschadet bleiben wird, wenn sich zukünftig einzelne Bausteine als weniger belastbar erweisen sollten.
Seit Niederschrift des Vorwortes für das ODING-Wizzod - Weihnachten 1992 - sind mehr als zwanzig Jahre vergangen. Ich ruhte mich zwischenzeitlich nicht auf Eichenlaub aus, denn man hat mir daraus keine Kränze gewunden, im Gegenteil. Von schweigender besserwisserischer Ablehnung bis zu empörten Attacken reichte die Ernte, die ich für dieses Buch empfing. Zwar schrieb mir der namhafte dt. Philologe und Runenfachmann Prof. Klaus Düwel am 23.01.1994 einen handschriftlichen Brief, in dem er sagte: „Das Semesterende ist leider mit vielerlei Arbeiten randvoll. Deshalb nur diesen Hinweis: Ich bezweifele nicht, daß die von Ihnen vorgelegte Lösung zur Reihenfolge des älteren Futharks in sich stimmig und wohl auch richtig ist. Das Problem liegt an anderer Stelle: Sie machen zahlreiche Voraussetzungen, von denen Sie plausibel machen müßten, daß diese zur Zeit der Runenschöpfung, der Entstehung und Ordnung der Futhark-Reihe, in dem geographischen Raum und im geistigen Horizont der an der Schöpfung der Runen beteiligten Person(en) auch eine Rolle gespielt haben. Wo ist die ,altheilige Weltgeist- / Geistsonnenzahl 21‘ dabei belegt, was hat sie mit Wodan zu tun? (die Ordnung Asen / Wanen ist wesentlich nur aus der nordischen späten Überlieferung bekannt).“
Diese zustimmenden Worte klangen wie eine Aufforderung, noch hinreichendere Beweise für meine Erkenntnistheorie vorzulegen. Das soll nun in Gestalt des neuen ODING-Wizzod geschehen. Dem weisen Heraklit wird das Wort zugeschrieben: „Durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden.“ Je geringerdas geistige Rüstzeug der Leser war, um so maßloser geriet zuweilen ihre Ablehnung meiner „linksverdrehten Runen“. Ich dachte, mit meinem Entdeckungswerk dem Germanen- und Keltentum ein Geschenk zu machen -, auch ein Stück Wiedergutmachung zu leisten, für all die geistigen Entrechtungen und Zerstörungen die zuerst vom römischen Staats- und später vom gleichnamigen Kirchenimperialismus ausgingen. Der römische Staat, der so oft seinen Fuß auf den Nacken unserer Vorfahren setzte, brachte mit seiner Pax Romana stets einen Frieden der Not, der Verfremdung und der Unterdrückung, wie Tacitus in seiner Agricolabiographie (Kap. 30, 4) den Anführer eines Aufstandes im Jahre 83 in Britannien, Calgacus, bitter beklagen lässt: „Diese Räuber der Welt [die Römer] durchwühlen, nachdem sich ihren Verwüstungen kein Land mehr bietet, selbst das Meer; wenn der Feind reich ist, sind sie habgierig, wenn er arm ist, sind sie ruhmsüchtig, nicht der Orient, nicht der Okzident hat sie gesättigt; als einzige von allen begehren sie Reichtum und Armut in gleicher Gier. Plündern, Morden, Rauben nennen sie mit falschem Namen Herrschaft [Imperium], und wo sie eine Einöde hinterlassen, da nennen sie es Frieden". Nach seinem endlichen Untergang aber ging dieser fast nahtlos in einen zunächst vorgeblich rein geistlichen neuen römischen Terrorismus über. Wieder war unsere Heimat aufs Schlimmste betroffen. In den Edikten röm. Kaiser, wie jene von Theodosius II und Valentinian III vom 14. Nov. 435, heißt es: „Wir verbieten allen Personen mit verbrecherischer heidnischer Gesinnung das Opfern von Tieren, andere verdammungswürdige Opfer und Handlungen, die durch frühere Gesetze untersagt wurden. Wir befehlen, dass alle Heiligtümer, Tempel und Schreine, wenn sie noch bestehen sollten, auf Anordnung der Behörden zerstört werden, und dass die Stätte durch Errichtung des verehrungswürdigen Zeichens der christlichen Religion entsühnt werden sollen. Alle sollen wissen, dass die Übertreter dieses Gesetzes mit dem Tode zu betrafen sind, wenn ihre Schuld vor einem ordentlichen Richter erwiesen wird.“ „Ordentliche Richter“ finden sich auch heute noch, wenn es gilt, der Staatsdoktrin einer zweifelhaften „christlich-abendländischen Wertegemeinschaft“ Geltung zu verschaffen. Dagegen gedachte ich Befreiungswege in die neue-alte eigengesetzliche Religiosität und Geistigkeiteröffnet zu haben -, ich erwartete Zustimmung wie Mitarbeit. Doch als massive Angriffe kamen, blieben mir zum Trost die Worte derer, welche vor mir die Launen des literarischen Publikums erlebten. So schrieb Goethe an Zelter am 12.12.1812 und 5.2.1813: „...Und da die Deutschen von jeher die Art haben, daß sie es besser wissen wollen als der, dessen Handwerk es ist, daß sie es besser verstehn als der, der sein Leben damit zugebracht, so werden sie auch dießmal einige Gesichter schneiden...“- „Die Deutschen haben die eigene Art, daß sie nichts annehmen können, wie man’s ihnen giebt, reicht man ihnen den Stiel des Messers zu, so finden sie ihn nicht scharf, bietet man ihnen die Spitze, so schreyen sie über Verletzung. Sie haben so unendlich viel gelesen und für neue Formen fehlt ihnen die Empfänglichkeit.“
Nun, dass den Deutschen die Empfänglichkeit für neue Formen abginge, wäre kein völlig gerechter Vorwurf, vielmehr scheinen sie allein das Andersartige überzubewerten und an einer geistigen Abwehrarmut gegen Fremdkulturelles zu kranken. Aus Sebastian Francks „Chronika", 1531, stammt der Satz: „Wer der Teutschen Acht hat, der findt diesen Fürwitz, Mangel, äffische Art an ihnen, daß sie aller Dinge eher Acht haben, nachfragen, bewundern, dann ihrer eygenen Dinge. Da fahren und wandern sie durch alle Land, bis zu den äußersten Inseln, erspähen fürwitzig all Ding, und sich selbs wissen sie nit." Und der Dichter unseres Nationalliedes, Hoffmann von Fallersleben, sang 1873: „Welcher Frevel, welche Schande, / daß in deutschem Vaterlande / Fremdes fand die Oberhand! / Deutsche Sprache, deutsche Dichtung, / deutsches Streben, deutsche Richtung / gilt als Nebensach und Tand. / Ja man lehrt uns, daß wir lernen / uns von dem früh zu entfernen, / was uns sein muß Ehr und Pflicht. / Was wir gern am liebsten wüßten / und vor allem lernen müßten / das gewährt kein Unterricht.“
Und Theophrast von Hohenheim (1493-1541), der sich selbst Paracelsus nannte, traf in seiner Einführung zum „Herbarius“ das deutsche Kernproblem: „Weil ich sehe, daß die Arznei der deutschen Nation von fernen Landen mit großen Kosten, Mühe und Arbeit, und mit vieler Sorgfältigkeit kommt, hat mich solches bewogen, ein Argument zu nehmen, ob nicht die deutsche Nation solches selbst in ihrer Gewalt hätte und ohne die fremden Übermeerischen auch in ihrem Umkreis und Reich bestehen möchte. Dabei hat es sich gefunden, sehr wohl und mit genügenden Grunde, daß alle Dinge auf eigenem Boden, Gründen und Gütern, für eine jegliche Krankheit überflüssig genug, zu haben sind, wie ihr dieselben auch entgegen stehen und zuhanden kommen mögen. Und zudem noch viel mehr Arznei und bessere, als Arabia, Chaldaea, Persia, Graecia zu geben vermögen, so daß es billiger wäre, sie holten ihre Arznei von uns Deutschen denn wir von ihnen. Auch (ist sie) dermaßen gut, daß auch Italia und Gallia usw., sich dess‘ nit überheben können. Daß aber das eine solche lange Zeit nit an den Tag oder hervorgekommen ist, hat Italia getan, das ist eine Mutter der Unwissenheit und Unerfahrenheit; sie haben die Deutschen dahin gebracht, daß sie auf ihr eigen Gewächs nichts gehalten haben, sondern alles aus Italia zu nehmen oder übers Meer her. Das ist der Grund aber, daß ihnen der Nutz aufgegangen ist und demselbigen sind sie nachgegangen, und nicht brüderlicher Liebe, die doch in ihnen ganz oder doch nahezu erkaltet ist. Nun ist es nicht minder, daß die deutschen Doktoren welsch sind und nach der welschen Lehre handeln und machen uns Deutsche zu Walen, die wir doch deutsch sind, mit den Walen aber gar kein commercium, das ist Gemeinschaft haben. Aber das ist deshalb, weil die Bücher aus Graecia, Arabia usw. kommen, und weil sie dort gemacht sind, nehmen sie es auch von den Orten und wollen deshalb die selbigen Arzneien haben. So kommen Bücher und Arzneien aus e i n e m Nest, und weder ist es deutsch noch den Deutschen besser als das, das deutsch ist. Einem jeglichen Lande wächst seine Krankheit selbst, seine Arznei selbst, sein Arzt selbst. Es ist aber not, daß die welsche Verführung ausgerottet werde, wie ein Baum, der gar keine Frucht bringt. Drum muß ich wohl darüber lachen, daß die Deutschen arabisch, griechisch, chaldäisch usw. sind, und können das Deutsche nicht; wollen auf welsch arzneien und wissen auf Deutsch nichts, wollen übers Meer arzneien, und ein besseres ist im Garten vor ihrem Hause ...“
Der große Arzt beschrieb hier mit der Fremdentümelei das Hauptübel der deutschen Lande und erklärte auch treffsicher deren Grund und die anzuratende Abhilfe: Das frühe imperiale Übergewicht von Rom und Italien, dann obendrein noch der judäochristliche Religionsimport, verführte die sich bildende deutsche Nation zum dauerhaften ehrfürchtigen sowie auch hilfesuchenden Blick über die eignen Grenzen. Eine wirkliche Heilpflege deutscher Krankheiten wird aber nur mit deutschen Arzneien, deutschen Büchern, also deutschem „Kraut“ gelingen. So würde einem entsprechenden deutschen Bedürfnis auch nur eine deutsche Spiritualität, Esoterik und Religion voranhelfen können - eben die eigengeistig-runische. Die wäre, von den ernsthaft Suchenden, zukünftig mit dem ODING’schen Maßstab gerüstet, wohl wiederzugewinnen. Das Ringen um das Leben eines Gemeinwesens wird ja weder durch die Wissenschaften, noch durch Volkswirtschaften entschieden, sondern allein in den Seelen, denen entweder die Kraft aus einem lebendigen Mythos zuwächst oder nicht. Ein solches Elexier könnte aus der Runen inhaltsschweren Botschaft schon gezogen werden. Wir haben die verlorene Eichel des einstigen großen starken Eichbaumes wiedergefunden und neu ins Erdreich gebettet, nun wächst sie und soll gute starke Frucht tragen für unser Volk ! In der Eichel steckt das gesamte Baumuster des späteren Baumes, ebenso schlummert im ODING-Samen die gesamte Konzeption des großen Heidentums unserer Vorfahren, eben darin liegt ja die Genialität eines jeden Schöpfers, in ein kleines unscheinbares Gebilde eine Wirk- und auch Sprengkraft - wie sie jeder Knospe innewohnt - hineingelegt zu haben, aus der eine Welt erwächst und sich ihre Bahn bricht.